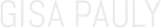DIE HEBAMME VON SYLT | DIE HEBAMME VON SYLT
Verlag | Rütten & Loenig (Aufbau-Verlag)
Erscheinungsdatum | Ende April 2011
LESEPROBE:
Es war das Jahr 1872. Ein kalter Sommer, der noch nicht viele heiße Tage gehabt hatte! Das Unwetter, das über die Insel fuhr, war nicht das erste dieses Sommers, aber das schlimmste. Der Sturm jagte die Wellen gegen den Strand, das Tosen der Brandung war auf der ganzen Insel zu hören. Viele Klänge hatte er, dieser Wind, er heulte in den Fenstern und Türen, pfiff im Reet der Dächer und fuhr mit dem Schrei einer Möwe nieder, als hätte der Sturm einen spitzen Schnabel und scharfe Krallen. Am schlimmsten aber war das Fauchen des Meeres, das ferne Grollen der Wellen, ihr Brüllen, wenn sie sich überschlugen, sich auf den Sand warfen und sich zischend zurückzogen, als wollten sie eine Warnung hinterlassen. Aus einem schwülen, drückenden Tag war dieser Sturm entstanden, einem Tag, an dem jeder auf ein reinigendes Gewitter gehofft hatte. Dass daraus ein solches Wüten, eine derartige Wucht, eine so kalte, vernichtende Kraft entstehen würde, hatte niemand erwartet. Auch die alten Seefahrer nicht, die sich mit allen Wetterlagen auskannten, die nur lange in den Himmel blicken mussten, um dann an den Wolkenbildungen, der Windrichtung und dem Verhalten der Möwen zu erkennen, was der Insel bevorstand. Sie alle hatten diesmal versagt.
Geesche fragte sich, wie viele Fischer hinausgefahren sein mochten. Jens Boyken, das wusste sie, hatte sich aufgemacht. Gegen Mittag war sie an seinem Haus vorbeigekommen, da hatte er seine Netze bereitgemacht und die Reusen zusammengelegt.
„Willst du Freda wirklich allein lassen?“, hatte sie ihn gefragt.
"Du hast gesagt, es kann noch eine Woche dauern“, hatte Jens in seiner mürrischen Art zurückgegeben. „Soll ich eine Woche auf den Fang verzichten? Und was, wenn es zwei Wochen werden?“
Es konnte aber auch schon in der nächsten Nacht losgehen. Gerade in den Sturmnächten wurden viele Kinder geboren. Wenn sich in der Natur etwas veränderte, setzten die Wehen oft früher ein, wenn das Wetter umschlug, der Mond wechselte oder eine Gefahr näher kam. Freda würde Angst vor dem Alleinsein haben, vor allem wenn Ebbo den Vater begleitet hatte. Ob sie zu ihr ging, um nach ihr zu sehen?
Nachdenklich ging Geesche zum Fenster der Küche und blickte hinaus. Die Nacht war schwarz, kein Stern zu sehen, der Mond hinter den Wolken verborgen. Sie jagten vermutlich über den Himmel, aber so dicht waren sie, dass sie kein Licht hindurch ließen. So war der Sturm nur zu hören, nicht zu sehen.
Wo mochte Andrees sein? Hoffentlich war er nicht von seinem Vater gebeten worden, mit hinauszufahren. Andrees ließ sich gerne bitten, das wusste Geesche. Eigentlich war er immer noch Fischer mit Leib und Seele, hatte nie etwas anderes sein wollen. Dass er nun dabei half, die Trasse zu bauen, auf der mal eine Inselbahn fahren sollte, war sein größtes Unglück. Doch ein Fischerboot ernährte nur eine Familie, und selbst das nur mit Müh und Not.
„Soll ich warten, bis mein Vater zu alt und zu schwach ist, um die Netze zu heben? Warten, dass er mir sein Boot überlässt?“
Dass dieser Tag kommen würde, war zwar eine kleine Hoffnung, aber keine wirkliche Perspektive. Und dem Vater ein Ende des Fischfangs zu wünschen, das war sogar eine Sünde. Nein, Andrees brauchte ein eigenes Boot, um als Fischer sein Auskommen zu haben. Er brauchte es dringend. Die Arbeit für die Trasse der Inselbahn machte einen anderen Menschen aus ihm. Jeden Tag ein bisschen mehr. Morgen würde er wieder ein wenig unglücklicher sein als gestern, und übermorgen erneut davon reden, dass das Leben keinen Sinn machte, wenn er nicht täglich aufs Meer hinaus konnte. Und erst recht nicht, wenn er sein Geld mit etwas so Sinnlosem verdiente wie der Idee, dass irgendwann eine Eisenbahn über die Insel fahren und Sommerfrischler vom Hafen Munkmarsch nach Westerland bringen sollte. Niemand glaubte an die ehrgeizigen Pläne von Dr. Julius Pollacsek, der aus Westerland ein bühendes Seebad machen wollte. So hatte der selbst ernannte Kurdirektor auch nur wenig Unterstützung auf Sylt gefunden. Kaum jemand wollte ihm dabei helfen, die Voraussetzungen für die Inselbahn zu schaffen, die Dr. Pollacsek sogar selbst finanzieren wollte. Lediglich einen Haufen junger Männer gab es, die irgendwie ihr Auskommen suchten und froh über die Beschäftigung waren. Sogar einige Strandräuber waren darunter, die jede Gelegenheit nutzten, zu Geld zu kommen.
„Was ist das für eine Arbeit!“, klagte Andrees oft. „Ich tu was Sinnloses, nur um nicht zu verhungern. In zwanzig Jahren wird niemand mehr wissen, warum etwas so Überflüssiges wie dies Eisenbahntrasse gebaut wurde. Eine Inselbahn? Sinnlos! Alles sinnlos!“
Jedes Mal, wenn er das sagte, hatte Geesche Angst, dass er bald auch keinen Sinn mehr darin sehen könnte, sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr auszumalen. Manchmal fürchtete sie sogar, dass er in seiner eigenen Zukunft keinen Sinn mehr sah. Was sollte geschehen, wenn er den Sinn des Lebens aus den Augen verlor?
Sie riss sich vom Fenster los, verließ die Küche und trat auf den Flur, der das Haus in Wohn- und Wirtschaftsteil gliederte, wie es in friesischen Häusern üblich war. Aber Geesche hatte diese Aufteilung verändert. Aus der Kammer des Wirtschaftsteils hatte sie den Raum gemacht, in dem die Frauen gebären konnten, die bei ihr, der einzigen Hebamme der Insel, Hilfe suchten, aus der Dreschtenne sollte demnächst ein Raum werden, der an Sommerfrischler zu vermieten war. Immer mehr kamen nach Sylt, manche blieben sogar den ganzen Sommer. Und wenn die Inselbahn zwischen dem Fährhafen Munkmarsch und Westerland wirklich einmal fahren sollte, würden es noch mehr werden. Vielleicht konnte sie dann auch den Stall umbauen, der an der Westseite die ganze Tiefe des Hauses einnahm. Sommerfrischler brachten Geld auf die Insel, und Geesche brauchte Geld, damit Andrees sich sein eigenes Fischerboot kaufen konnte. Aber sie brauchte es bald. Bis die Inselbahn ihre erste Fahrt machte, würden noch viele Jahre vergehen. Wenn die Pläne von Dr. Pollacsek überhaupt in die Tat umzusetzen waren! Andrees glaubte nicht daran.
Ein so gespenstisches Heulen fuhr unter der Eingangstür her, dass Geesche sich erschrocken an die Wand drängte. Wenn Andrees doch nur daran glauben könnte, dass es für Sylt eine neue Zukunft gab, wenn immer mehr Fremde auf die Insel kamen! Dr. Pollacsek behauptete, es kämen fette Jahre auf diejenigen zu, die Fremdenzimmer zu vermieten hatten. Und ihr Haus war groß genug dafür! Sie würden ihr Auskommen haben, wenn auch Andrees sich auf Dr. Pollacseks Ideen einließ.
Aus dem Stall drang aufgeregtes Gackern, als der Wind einen schweren Eimer von Haus zu Haus trieb und ihn gegen die Stalltür schlug. Wie lange würde Andrees sein Unglück noch ertragen? So lange, bis sie den Stall zu Fremdenzimmern gemacht hatte? Geesche schüttelte den Kopf. Nein, so viel Zeit würde ihr das Schicksal wohl nicht lassen, das spürte sie.
Noch war der Stall in dem Zustand, in dem er gewesen war, als ihr Vater das Haus von seinen Eltern übernommen hatte. Zu seinen Lebzeiten waren dort Schweine und Federvieh gehalten worden. Als er starb und auch die Mutter bald das Zeitliche segnete, hatte Geesche sich entschlossen, die Schweine abzuschaffen. Nun hielt sie nur noch ein paar Hühner und Enten dort. Die Schafe, die sie außerdem besaß, kamen nicht in den Stall, sie blieben bei jeder Wetterlage auf der Weide. Wenn sie den Hühnern und Enten einen Verschlag im Garten bauen ließ, würde sie in dem jetzigen Stall auch Fremdenzimmer einrichten können.
Geesche nahm die Öllampe mit ins Gebärzimmer und leuchtete es aus. Ja, alles war an seinem Platz. Sollte Freda Boyken heute noch niederkommen, würde sie hier frische Laken vorfinden, ein sauberen Bottich für das Wasser, das Geesche auf der Feuerstelle ihrer Küche warmhielt, und alles, was für den Säugling gebraucht wurde, wenn er auf der Welt war. Auch Brot, Getreidegrütze und Bier hielt sie bereit, falls die Mutter nach der Geburt bereit war für eine Stärkung, wie Geesche sie gern empfahl.
Sie ging zurück in den Flur, wo ein großes wollenes Tuch auf einem Haken hing. Das legte sie sich gerade um, als sie spürte, dass jemand auf das Haus zukam. Schritte waren nicht zu hören, dazu war das Fauchen und Heulen des Windes zu laut, aber dass der Kies knirschte, blieb Geesche dennoch nicht verborgen. Sie kannte die Geräusche der Insel, wusste jeden Ton zu deuten, den sie erlauschte. Schon wieder raschelte es im Kies. Andrees? Warum kam er leise und heimlich zu ihr? Oder schleppte er sich mühsam zu ihrer Tür? Ging es ihm schlecht? Noch schlechter? So schlecht, dass er es nicht mehr aushielt?
Derart heftig stieß Geesche die Tür auf, als käme es auf jede Minute an. Als könnte Andrees im nächsten Augenblick noch zu retten sein und schon im übernächsten davon reden, dass er ins Watt gehen würde, weil das Leben keinen Sinn mehr machte, wenn er kein Fischer sein durfte.
Mit aller Kraft hielt sie die Tür fest, damit der Sturm sie ihr nicht aus der Hand schlug. Aber sie konnte nicht verhindern, dass er mit gierigen Böen ins Haus fuhr, nach der Wärme griff und sie an sich riss.
Freda Boyken war es, die mit schweren Schritten aufs Haus zukam. Geesche sah sofort, dass ihre Stunde gekommen war. Sie streckte Freda die Hand entgegen, ergriff sie, kaum dass sie sie erreichen konnte, ohne die Tür dem Wind zu überlassen, und zog sie ins Haus.
„Seit wann hast du Wehen?"
Freda richtete sich stöhnend auf und griff sich in den Rücken, als Geesche die Tür geschlossen hatte und die wirbelnde Kälte zu Boden gesunken war. „Noch nicht lange“, sagte sie. „Aber ich dachte, es ist besser, wenn ich schon jetzt zu dir komme. Falls der Sturm noch schlimmer wird …“
„Dann hättest du am Ende den Weg nicht mehr geschafft“, vollendete Geesche und schob Freda zur Tür des Gebärzimmers. „Ist Ebbo etwa mit Jens rausgefahren?“
Freda schüttelte den Kopf. „Er will zum Strand gehen und sich umhören. Vielleicht ist einer der Fischer rechtzeitig umgekehrt und weiß, was mit den anderen geschehen ist.“ Freda ging zu dem Strohlager in der Mitte des Raums, über das Geesche frische weiße Laken gebreitet hatte. Sie drehte sich nicht um, als sie fragte: „Er wird doch zurückkommen? Er wird doch nicht ausgerechnet heute …?“
Geesche erwartete nicht, dass sie den Satz zu Ende sprach, und sie beantwortete die Frage nicht. Dass ein Fischerboot nicht zurückkehrte, gehörte zum Sylter Alltag. In einem solchen Fall war es eine Gnade, wenn der Fischer Tage später an den Strand gespült wurde und dort beerdigt werden konnte, wo seine Wurzeln waren. Das Allerschlimmste war, wenn ein Fischer auf See blieb.
Geesche ging zu ihr, als Freda sich unter der nächsten Wehe krümmte. Sie betastete ihren Leib, dann griff sie zu Fredas Hand. „Das dauert noch“, sagte sie. „Lass uns in die Küche gehen und einen Becher Tee trinken. Dort ist es warm, da vergeht die Zeit leichter und schneller als hier.“ Sie nickte zu dem Strohbett, das weder warm noch bequem aussah, sondern nichts als zweckdienlich war. Wenn die Geburt in Gang war, würde Freda von der Kälte in diesem Raum nichts mehr spüren. Aber bis es soweit war, war sie in der warmen Küche besser aufgehoben. Freda hatte Angst, das sah Geesche. Nicht nur vor der Geburt, sondern auch um ihren Mann. Wichtig war es jetzt, ihr Zuversicht zu geben und sie abzulenken.
Freda nickte dankbar und folgte Geesche. Schwer ließ sie sich in der Küche auf einen Stuhl fallen und stützte die Ellbogen auf den Tisch. „Wenn nur Jens da wäre …“
Geesche wandte Freda den Rücken zu, während sie den Tee aufgoss, weil sie fürchtete, dass ihrem Gesicht die Sorge abzulesen war. Wer in dieser Nacht hinausgefahren war, musste früh genug bemerkt haben, dass ein Wetter aufzog, dann war vielleicht noch Zeit zum Umkehren gewesen. Wer die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hatte, der kämpfte nun da draußen ums Überleben. Ob Andrees auch zu ihnen gehörte? Dann würde sie ihn vielleicht ans Meer verlieren. Noch in dieser Nacht! Andererseits war sie sicher, dass er gerade auf dem Meer um sein Leben kämpfen würde wie alle anderen und den Kampf erst verloren geben würde, wenn der blanke Hans nach ihm griff! An Land ließ er sich schon lange nicht mehr aufs Kämpfen ein. Hier gab er sein Leben Stück für Stück hin, als wäre es nichts wert. Im Boot seines Vaters aber würde ihm das Leben kostbar genug sein, um es gegen die Naturgewalten zu verteidigen. Ja, überleben würde er am ehesten auf dem Meer. Aber was kam dann?
„Nur gut, dass dein Andrees nicht mit seinem Vater hinausgefahren ist", sagte Freda in diesem Augenblick.
Geesche fuhr zu ihr herum. "Woher weißt du das?“
"Seine Tante war bei mir, kurz nachdem Jens losgezogen war. Sie sagte, Andrees habe seinen Vater begleiten wollen, aber der wollte es nicht zulassen. Weil Andrees doch schon in der Frühe von Dr. Pollacsek erwartet wird. Wie soll er für ihn arbeiten, wenn er in der Nacht auf See war und nicht geschlafen hat? Und was wäre, wenn die Fischer nicht pünktlich zurückkommen? Dann verliert er womöglich seine Stelle. Und was dann?“
Freda sah Geesche fragend an. Aber die zuckte nur mit den Schultern. Was dann? Das eine war für Andrees so schrecklich wie das andere. Die Arbeit an der Trasse der Inselbahn machte ihn genauso unglücklich wie die Aussicht auf ein Leben in tiefer Armut, weil er keine Arbeit hatte, um sein Leben zu fristen. Wer als Halmreeper mit dem Drehen von Halmen für Wäscheleinen und Binsen für sein Auskommen sorgen musste oder als Fischer auf dem Boot eines anderen, der verdiente kaum sein tägliches Brot. So einer schloss sich oft den Strandräubern an, um zu überleben. Aber Andrees würde vermutlich nicht einmal das tun. Wieder griff die Angst nach ihr, dass sie Andrees an ihren Traum von der Zukunft verlieren würde.
„Wenn er doch endlich sein eigenes Boot hätte“, sagte sie, „dann könnte er wieder glücklich sein.“
Sie stellte fest, dass Freda ruhiger wurde, als sie einen Becher mit heißem Tee in der Hand hatte und ihn vorsichtig schlürfte. Gelegentlich setzte sie ihn ab, schloss die Augen, beugte sich vor, legte die Stirn auf die Tischplatte und stöhnte leise. Aber die Abstände zwischen den Wehen waren noch groß. Fredas Kind würde erst in ein paar Stunden zur Welt kommen. Heimlich hoffte Geesche, dass Jens Boyken bis dahin zurückgekehrt war.
Das Schweigen trat nun in die Küche wie ein hoher Gast, der alle anderen mundtot machte. Freda war in Gedanken bei ihrem Mann, dachte an die bevorstehende Geburt, faltete die Hände, als wollte sie um göttlichen Beistand bitten. Geesches Gedanken wanderten zu Andrees. Ob er auch zum Strand gegangen war, um nach den heimkehrenden Fischern Ausschau zu halten? Oder nach dem ersten Strandgut, mit dem das Unheil verkündet wurde? Dann würde er hoffentlich auf Ebbo, Fredas Stiefsohn, aufmerksam werden und dafür sorgen, dass der Siebenjährige sicher nach Hause kam und bei den Nachbarn Unterschlupf fand, bis Freda wieder bei Kräften war.
Das Heulen des Windes verlor sein Gleichmaß. Es gab nun Augenblicke, da fiel es in sich zusammen, da tat sich eine kurze, unheimliche Stille auf, dann aber rüttelte der Sturm umso heftiger an den Türen und Fenstern.
In eine winzige Flaute hinein drang plötzlich ein anderes Geräusch, ein sorgloses, das nicht in diese Sturmnacht passte, ein leichtes Klappern, ganz und gar unwirklich für diesen finsteren bedrohlichen Abend.
Auch Freda war aufmerksam geworden. Und sie sprach aus, was Geesche nicht glauben mochte: „Pferde?“ Und dann, als sich neben dem Getrappel auch das Rumpeln großer Räder näherte: „Eine Kutsche?“
Geesche sprang auf und lief auf den Flur. Dort blieb sie stehen und lauschte. Nun wieder schien nur der Sturm vor dem Haus zu stehen, aber das Hufgetrappel und die Räder der Kutsche hatten sich nicht entfernt, nein, sie waren zum Stillstand gekommen.
Geesche raffte ihr wollenes Tuch vor der Brust zusammen, bevor sie die Tür öffnete. Die Kutsche, die vor ihrem Haus stand, erkannte sie sofort. Sie gehörte dem Grafen von Zederlitz, der mehrere Monate des Jahres auf Sylt verbrachte. Den Kutscher, der nun auf Geesche zutrat, hatte er von seinem schleswig-holsteinischen Gut mit nach Sylt gebracht.
Der Mann tippte mit der rechten Hand an seine Mütze während er sie mit der linken festhielt. „Mein Herr schickt mich“, sagte er. „Ich soll die Hebamme holen. Bei der Gräfin haben die Wehen eingesetzt.“ Er wies zur Kutsche. „Bitte! Es eilt!“
Geesche hörte ein Scharren hinter sich und drehte sich um. Freda war in der Küchentür erschienen und starrte den Kutscher ängstlich an.
„Das geht nicht“, sagte Geesche und gab dem Mann einen Wink, damit er eintrat und sie ihr Haus vor dem Wind verschließen konnte. „Ich habe schon eine Gebärende aufgenommen. Die kann ich nicht allein lassen.“
Der Kutscher betrachtete Freda, die zur Tür des Gebärzimmers ging, als wollte sie damit ihr Recht verdeutlichen.
„Aber mein Herr hat mir aufgetragen …“, begann er, brach dann aber ab, weil er einsah, dass die Hebamme eine Frau, die sich soeben in ihre Obhut begeben hatte, nicht wegschicken konnte. Ratlos sah er sie an. „Was soll ich meinem Herrn sagen?“
„Bring die Frau Gräfin zu mir“, antwortete Geesche. Und als der Mann zögerte, ergänzte sie: „In der Kutsche hat sie es bequem. Ich richte währenddessen alles her.“ Und beruhigend, damit der Kutscher unbesorgt zurückfahren und ohne Angst vor seinen Herrn treten konnte, fügte sie an: „Ich bereite für die Frau Gräfin in der Küche ein Lager vor. Dort ist es warm.“
„In der Küche?“ Der Mann sah sie zweifelnd an.
Geesche schob ihn zur Tür. „In meiner Küche gibt es einen Alkoven. In das Bettzeug gebe ich einen Bettwärmer. Sie wird es bequem und warm bei mir haben, das verspreche ich. Sag deinem Herrn, es ist alles bereit für seine Gemahlin.“ Sie öffnete die Tür und drängte den Kutscher aus dem Haus. „Trödel nicht! Je eher die Gräfin zu mir kommt, desto besser.“
Dem Kutscher war nicht wohl zumute, aber er verzichtete auf jeden Disput. Kurz darauf drangen seine Rufe durch den Wind, mit denen er die Pferde antrieb.
Freda stand noch immer ängstlich in der Tür des Gebärzimmers. „Keine Sorge, Freda“, sagte Geesche, „ich werde es schon schaffen, mich auch um dich zu kümmern.“
Sie betrachtete Freda besorgt, die sich in der nächste Wehe krümmte. Freda wir Erstgebärende, die Geburt konnte sich noch stundenlang hinziehen. Die Gräfin dagegen hatte schon zwei oder drei Totgeburten erlitten, Geesche wusste auch von mehreren Fehlgeburten. Wenn sie im Haus der Hebamme ankam, würde vermutlich alles schnell gehen. Geesche biss sich auf die Lippen. Hoffentlich konnte sie der armen Frau ein gesundes Kind in die Arme legen.
Freda riss sie aus ihren Gedanken. „Meinst du, der Graf ist bereit, seine Frau durch diese Sturmnacht zu kutschieren?“
„Er wird es müssen“, sagte Geesche und fühlte sich längst nicht so resolut, wie sie sich gab. „Hoffentlich beeilt der Kutscher sich.“ Dann gab sie sich einen Ruck und ging in die Küche. „Leg dich hin“, rief zurück.
Aber Freda folgte ihr. „Ich helfe dir“, sagte sie. „Das lenkt mich ab.“
Während Geesche die beiden Flügeltüren des Alkovens öffnete, füllte Freda den Sand in den Bettwärmer, den sie auf der Feuerstelle erhitzte, damit er der Gräfin ins Bett gelegt werden konnte. Geesche riss die Laken herunter, obwohl bisher niemand darauf gelegen hatte, und breitete frische über dem Stroh aus.
Das Alkovenbett in der Küche wurde selten benutzt, Geesche schlief in dem Alkoven des Wohnzimmers. Aber jedes friesische Haus hatte auch in der Küche einen Alkoven, damit ein Familienmitglied, das krank war, in der Küche einen warmen Platz hatte und nicht allein sein musste.
Ob die Gräfin damit zufrieden sein würde? Dass sie eine bevorzugte Behandlung erfuhr, indem sie in der warmen Küche gebären durfte, würde ihr vermutlich nicht aufgehen. Sie hatte selbstverständlich erwartet, in ihrem eigenen Bett niederzukommen, umgeben von den Dienstboten, die sie mit nach Sylt gebracht hatte, und gewöhnt an den Komfort, den ihr Haus bot. Geesche spürte, dass Angst in ihr hochstieg. Was, wenn auch diese Geburt kein gutes Ende nahm? Dieses Kind des gräflichen Paares war das erste, das auf Sylt geboren werden sollte. Was würde mit der Hebamme geschehen, wenn auch dieses Kind tot zur Welt kam? Der Gedanke an Andrees schoss wie ein Blitz durch ihren Kopf. Wenn sie ihren guten Ruf als Hebamme verlor, würde es mit ihrer gemeinsamen Zukunft noch schlechter bestellt sein. Zwar wurde sie meistens nicht mit Geld, sondern mit Essbarem entlohnt, aber diese Arbeit sicherte ihr Leben und konnte auch das Überleben eines Mannes sichern. Vorausgesetzt, dieser Mann war nicht zu stolz, ihre Hilfe anzunehmen …
Als erneut das Pferdegetrappel durch den Wind drang, fragte Geesche sich, ob der Graf es zulassen würde, dass sie sich auch um Freda kümmerte, während seine Frau in den Wehen lag. Geesche würde Gelegenheit haben, ihr Fingerspitzengefühl zu beweisen. Und als sie Freda ins Gesicht sah, wurde ihr klar, dass sie die gleichen Gedanken hatte.
„Es wird alles gut“, sagte Geesche, ehe sie zur Tür ging.
Als sie öffnete, drang der scharfe Ruf eines Mannes an ihr Ohr, der es gewöhnt war zu befehlen. Der Kutscher hob die Gräfin aus der Kutsche und trug sie Geesche entgegen, gefolgt von dem Grafen, der nervös und ungehalten war.
„Ich habe Sie in meinem Haus erwartet“, herrschte er Geesche an, während der Kutscher die Gräfin vorsichtig auf die Füße stellte.
„Sie wissen doch …“, begann Geesche, aber jede Erklärung wurde überflüssig, als Fredas unterdrückter Schrei aus der Küche drang.
Entsetzt sah die Gräfin zu der geöffneten Tür, in der Freda erschien und sich Mühe gab, einen Schritt vor den anderen zu setzen, um über den Flur ins Gebärzimmer zu gelangen. Als Geesche ihr beispringen wollte, wehrte sie erschrocken ab. Nein, die Gräfin hatte Vorrang! Freda hätte sich in Grund und Boden geschämt, wenn Geesche sich um sie gekümmert hätte, während Gräfin Katerina von Zederlitz auf die Zuwendung der Hebamme warten musste. Die arme Fischersfrau Freda Boyken war froh, dass sie in dem Haus bleiben durfte, in dem auch die Gräfin niederkam, und wenigstens darauf vertrauen konnte, dass ihr notfalls geholfen wurde, wenn sie es allein nicht schaffte, ihr Kind auf die Welt zu bringen.
Geesche verstand. Sie griff nach dem Arm der Gräfin, um sie in die Küche zu führen … und in diesem Augenblick geschah es. Das Haus war mit einem Mal in grelles Licht getaucht. Kein Blitz, nein, ein Leuchten, das dem Himmel für Sekunden seine Farbe nahm. Die Schwärze ging in einem weißen Schein auf, vor dem alles Große klein und alles Kleine noch winziger wurde. Scharf umrissen und rabenschwarz blitzte alles auf, was zu Sylt gehörte, auch das Inventar im Haus der Hebamme und die Menschen, die sich dort zusammengefunden hatten.
Als die Schwärze so schnell zurückkehrte, wie sie gegangen war und die Nacht sich wieder über diesen grellen Augenblick senkte, begriff Geesche, dass etwas geschehen würde. Dies war kein Wetterleuchten gewesen, es musste das Auflodern des Schicksals gewesen sein. Was würde in dieser Nacht geschehen? Ihre Hände zitterten, als sie die Gräfin in ihre Küche führte, und sie spürte, dass diese ihre Unruhe bemerkte …
Gegen Morgen wurden kurz hintereinander zwei Mädchen geboren, keine halbe Stunde nachdem es noch einmal ein Wetterleuchten gegeben hatte. Und als die Neugeborenen auf der Welt waren, bestätigte sich, was Geesche beim Eintreffen der Gräfin gefühlt hatte. Die Warnung des Schicksals! Während der Nacht hatte sie Mühe gehabt, beiden Frauen gerecht zu werden, der Gräfin gemäß ihrer Vorrangstellung die größere Aufmerksamkeit zu schenken, aber Freda darüber nicht ganz zu vergessen. Dass das Wetterleuchten wie eine Warnung gewesen war, hatte sie verdrängt, ebenso die Frage, wovor sie gewarnt werden könnte. Sie beantwortete sich später von selbst. Schon bald, nachdem die beiden Mädchen gewaschen, gewickelt und gemeinsam in die einzige Wiege gelegt worden waren, die Geesche besaß. Dicht nebeneinander lagen sie da, als gäbe es keinen Unterschied zwischen dem Neugeborenen einer Gräfin und einer Fischersfrau. So lange, bis der Graf eins der Mädchen heraushob und verlangte, dass es so schnell wie möglich in sein Haus gebracht wurde …