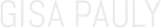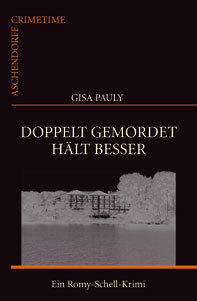DOPPELT GEMORDET HÄLT BESSER | DER DRITTE ROMY-SCHELL-KRIMI
Verlag | Aschendorff-Verlag Münster
Erscheinungsdatum | Februar 2007
LESEPROBE:
Ich hätte gern länger die Augen geschlossen. Das ferne Knacken der Zweige kam mir dann näher, das kaum wahrnehmbare Rascheln der Blätter, das rhythmische Saugen von Gummisohlen am feuchten Waldboden. Hastig, unvorsichtig. Flüchtende Schritte. Immer wieder versuchte ich, mich hinter den Lidern auf sie zu konzentrieren, auf diese Geräusche, die so weit entfernt waren, dass außer mir niemand sie zu hören schien. Und jedes Mal war ich mir sicher, dass etwas Unheimliches in diesem Wald vor sich ging. Wenn ich nichts sah, dann hörte ich es, das weit entfernte Rascheln, Knistern, Splittern, Knacken, Brechen und Reißen. Und immer wieder die Schritte. Oder bildete ich mir das alles nur ein? Waren das die Geräusche des Waldes, die zu ihm gehörten wie die Stille? Was wusste ich schon von ihnen? Wann war ich jemals mit dem Wald allein gewesen? Woher sollte ich wissen, was zu seiner Stille passte? Und ob die jagenden Schritte über den Waldboden nur die Flucht eines Tieres waren!
Nachdem ich vor den Stamm einer Kiefer gelaufen war und mich kurz darauf in den Dornen eines Brombeerbusches verfangen hatte, gab ich es auf und ließ die Augen geöffnet. Prompt hörte ich wieder nur die Geräusche in meiner Nähe, das Schnaufen, Murmeln, Naseputzen, das Schnarren eines Reißverschlusses, das Schlagen eines Zweiges, der sich in einer Jacke verhakt hatte und zurückschnellte.
Aber dann sah ich den Schatten, zehn, zwanzig Baumstämme weiter. Kein Tier, nein, eine aufrechte Bewegung, groß wie ein Mensch, schmaler als der Baumstamm, an dem sie abprallte und sich auflöste. Ein Phantom? Meiner überspannten Einbildung entsprungen?
Doch nur wenige Augenblicke später wieder dieses Huschen, dort, wo der nackte, dunkle Waldboden erst von dünnen Gräsern, dann von weichen Stauden und Büscheln gepolstert wurde und schließlich unter zottigem Gestrüpp verschwand. Etwas, was sich verbarg, jemand, der nicht gesehen werden wollte? Dann wieder! Aber diesmal war es kein Schatten, nur das Biegen robuster Ranken, zu heftig, um unter dem Wind entstanden zu sein, der nur die Baumkronen sanft auffächerte, aber den Waldboden nicht erreichte. Etwas, was sich hastig zurückzog, zu hoch für ein Tier, das sich duckt, bevor es flüchtet.
Diesmal blieb ich stehen, bevor ich die Augen schloss. Und wieder gelang es meinen Ohren, was meine Augen nicht schafften – ein Geräusch zu fixieren, das aus einiger Entfernung zu mir drang, außerhalb dieser Gruppe, die sorglos durch den Wald stapfte, ein Geräusch, das im Verborgenen entstand, geschützt von einem aufgeschreckten Vogel und von einem herabfallenden trockenen Ast. Bewegungen, die schneller waren als die, zu denen ich gehörte, die einer anderen Richtung folgten, die unentdeckt bleiben wollten.
Ich öffnete die Augen wieder und sah, dass ich Gefahr lief, allein zurückzubleiben. Nur das nicht! Mit ein paar schnellen Schritten machte ich mich wieder der Gruppe zugehörig, rundete meinen Rücken wie die anderen, heftete den Blick auf den Boden, schloss mich dem gleichen Ziel an. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass in meiner Nähe etwas geschah, was nicht geschehen durfte, dass etwas Unangenehmes auf mich zukam. So wie am vergangenen Mittwoch. Auch da hatte ich gespürt, dass etwas in der Luft lag, etwas heraufzog, sich über mir zusam-menbraute...
Meine Kinder waren zauberhaft gewesen an diesem Tag. Auf sech-zehnjährige Töchter und vierzehnjährige Söhne passt dieses Attribut nur selten und höchstens nach langen und vergeblichen Überlegungen, wie man an die total angesagten Turnschuhe oder die neue CD von Tokio Hotel kommen könnte. An meinem Geburtstag jedoch strahlte mir Uneigennützigkeit entgegen. Alexandra und Christopher hatten nichts anderes im Sinn, als mich zu erfreuen.
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama!“
Beide Kinder umarmten und küssten mich, und das, obwohl A-lexandra seit ihrem fünfzehnten Geburtstag jeden engen Körper-kontakt mit mir mied und Christopher ihn allenfalls heimlich suchte, wenn es niemand sah oder er vorgeben konnte, nicht be-merkt zu haben, dass er von mir geherzt wurde.
„Unser Geschenk bekommst du später", rief Alexandra mir zu, ehe sie die Stöpsel ihres MP3-Players in die Ohren steckte und sich aufs Fahrrad schwang.
„Wir wollen dein Gesicht sehen, wenn du es auspackst“, er-gänzte Christopher.
Damit hatten sie meine Spannung schlagartig ins Unerträgli-che katapultiert. Obwohl es mir wichtig war, dass Alexandra und Christopher ohne meine Unterstützung ihre Zimmer aufräumten und sauber hielten, beschloss ich, an diesem Tag eine Ausnahme zu machen. Scheinheilig saugte ich unter ihren Betten und holte alles ans Tageslicht, was dort den Wollmäusen zum Opfer gefallen war, aber nichts war dabei, was ein Mutterherz erfreuen konnte. Ich ordnete die Blätter, Hefte und Bücher auf den Schreibtischen so lange, bis ich sicher sein konnte, dass auch dort kein Geburtstagsgeschenk versteckt war, holte alle Kleidungsstücke aus den Schränken, die dringend ausgebessert werden mussten, und ging sogar so weit, auf den Schränken und unter den Blumentöpfen Staub zu wischen. Anschließend war ich dankbar, dass ich nichts gefunden hatte. Wie hätte ich mich geschämt, wenn ich später gezwungen gewesen wäre, Überraschung zu heucheln!
Die Asche wurde trotzdem auf mein Haupt geladen. „Sie hat unsere Zimmer aufgeräumt!“, hörte ich Christopher rufen, als die beiden aus der Schule zurück waren.
Schon erschien er wieder im Flur, seine gegelten Haare wie-sen zur Decke, als hätte er sie sich gerauft angesichts der Gewissenlosigkeit seiner Mutter. Allerdings verschwand er gleich wieder, als ich die Absicht erkennen ließ, seine weiten Jeans in die Höhe zu ziehen, deren Schrittnaht irgendwo in der Nähe der Kniekehlen baumelte. Der Sitz seiner Hose war Christopher heilig. Er liebte keine Korrekturen und unterbrach jedes Gespräch sofort, das darauf abzielte.
„Ich glaub’s nicht, Mama!“ Alexandra erinnerte mich mal wieder an meine Mutter, die auch stets so arrogant die Augen-brauen in die Höhe gezogen hatte, wenn ich bei einer Charak-terschwäche ertappt worden war. „Wie kann man nur so neugierig sein!“
„Neugierig? Ich?“ Es gelang mir ziemlich gut, so zu tun, als verstünde ich kein Wort.
Dennoch war ich froh, dass ich nicht zu weiteren Erklärungen und Ausflüchten genötigt wurde. Denn ein Schlüssel drehte sich im Schloss, was meine Kinder zum Glück von der Heimtücke ihrer Mutter ablenkte.
„Papa!“
Immer, wenn Ingo unangemeldet bei uns erschien und seinen Schlüssel benutzte, als wohnte er noch bei uns, fragte ich mich, wann ich endlich den Mut aufbringen würde, die Schlösser auszuwechseln oder von meinem Noch-Ehemann die Herausgabe des Schlüssels zu verlangen. Aber wie immer, wenn ich die Freude der Kinder sah, brachte ich weder das eine noch das andere fertig.
„Herzlichen Glückwunsch!“ Ingo zog mich in seine Arme, als hätte es nie Sandra, Gloria, Sabine, Bettina, Clara, Marlene und die vielen anderen gegeben, die mir namentlich nicht bekannt waren.
Entsprechend unwirsch wand ich mich aus seinen Armen. „Ich bin nicht mehr dein Liebling.“
Ingo seufzte gequält auf, warf Alexandra einen Blick zu, in dem das ganze Leid des unverstandenen Ehemannes lag, und erntete prompt das ungeteilte Mitleid seiner Tochter. Wie immer sah sie ihrem Vater gerne seine diversen Seitensprünge nach und schien den Tag vergessen zu haben, an dem er bei uns ausgezogen war, um bei seiner Kollegin Sandra zu leben. Jetzt zählte für sie nur, dass ich nicht bereit war, ihn wieder bei uns einziehen zu lassen, nachdem sein Leben an Sandras Seite doch nicht so wunderbar gewesen war, wie er gehofft hatte.
Wie ähnlich sich die beiden waren! Alexandra hatte die braunen Augen ihres Vaters geerbt und sein dunkles gewelltes Haar. Christopher war nicht so gut weggekommen. Wir quälten uns beide jeden Morgen vor dem Spiegel, um aus unseren glatten fingerhutlangen Haaren mit viel Gel eine Friseur zu erschaffen. Christopher hatte auch meine grauen Augen geerbt, die beim jeweils anderen Geschlecht selten Verzückung hervorriefen. Obwohl ich mich noch genau daran erinnerte, dass Ingo sie einmal einen klaren Bergsee genannt hatte...
„Der Strauß ist ja superschön“, schrie Alexandra exaltiert, damit ich nur ja nicht auf die Idee kommen konnte, irgendetwas an den blauen Astern, die Ingo mir feierlich überreichte, nicht optimal zu finden.
Diesen Satz wiederholte sie mehrmals, nachdem Maximilian mir einen Strauß überreicht hatte, der Ingos Gebinde nicht nur an Ausmaßen, sondern auch am Einfallsreichtum der Floristin bei weitem übertraf. Alexandra blieb dabei: Zehn blaue Astern waren viel schöner als ein Arrangement aus roten Rosen und weißen Lilien.
Die Situation war nun gespannt – wie immer, wenn Ingo und Maximilian aufeinander trafen. Die beiden gingen zwar höflich miteinander um, trotzdem lag immer etwas in der Luft, was zu explodieren drohte. Meist war es Alexandra, die die Lunte in der Hand hielt. Zum Beispiel, indem sie die Astern, die Ingo mir geschenkt hatte, in meiner besten Kristallvase anordnete, während sie Maximilians Strauß in einen alten Milchtopf steckte. Dass die blauen Astern mitten auf dem Tisch prunken durften und die roten Rosen auf die Fensterbank gedrückt wurden, verstand sich von selbst.
Ich gab Maximilian mit einem langen Blick zu verstehen, dass sein Strauß bei nächster Gelegenheit eine andere Vase und einen besseren Standort bekommen würde. Er erwiderte meinen Blick mit der gleichen Intensität und nickte mir gleichzeitig besänftigend zu. Wieder einmal bewunderte ich ihn für die Geduld, mit der er Alexandras Ablehnung ertrug.
Ich sah die vier an, einen nach dem anderen – und das war der Augenblick, in dem sich das unangenehme Gefühl einstellte, diese böse Ahnung, die Angst vor einem Hinterhalt. Ich be-trachtete Ingo, den Mann, mit dem ich immer noch verheiratet war, und spürte etwas Altvertrautes auf mich zukommen, das ich gerne abgewehrt hätte, dem ich aber hilflos gegenüberstand, weil ich es nicht erkannte, nicht sehen, nur spüren, erahnen konnte. Ich betrachtete Maximilian, den neuen Mann in meinem Leben, dem ich zu verdanken hatte, dass ich Ingo kein weiteres Mal seine Eskapaden nachgesehen hatte. Und das Gefühl, dass etwas Unangenehmes auf mich zukam, verstärkte sich. Dann betrachtete ich meine Kinder. Alexandra, die demonstrativ an Ingos Seite rückte. Christopher, der Maximilian verlegen anlächelte, weil er eine deutlichere Sympathiebekundung in Gegenwart seiner Schwester nicht riskierte. Mit aller Kraft versuchte ich die Mutlosigkeit, die auf mich zukroch, abzuwehren. Aber es gelang mir nicht. In den nächsten Stunden würde etwas passieren, ich war ganz sicher. Nur... was?
Es war das gleiche Gefühl der Bedrückung. Genauso wie an meinem Geburtstag war es jetzt erneut über mich gekommen. Und da es mich am vergangenen Mittwoch nicht getäuscht hatte, musste ich auch diesmal damit rechnen, dass ich mir die Gefahr nicht einbildete.
Verzweifelt versuchte ich mich auf das Geplauder in meiner Nähe zu konzentrieren, mich womöglich sogar daran zu beteiligen, um das quälende Gefühl zu überwinden oder zumindest zu verdrängen. Ich hörte, dass der Architekt aus Krefeld der Leh-rerin aus Mönchengladbach erzählte, dass er am Bau einer Rei-henhaussiedlung in Roxel beteiligt gewesen war. Und ich erfuhr, dass die Lehrerin in Münster zur Schule gegangen war und am Vormittag bei einem Bummel durch Hiltrup eine Klassenkameradin wieder getroffen hatte. Dass der Bauunternehmer aus Anröchte ein Krimifan war, hatte sich eigentlich schon herumgesprochen, trotzdem hörte ich, dass er es ein weiteres Mal verkündete. Ich lauschte auch den Worten der Dortmunder Hausfrau, die nicht müde wurde zu versichern, dass sie eigentlich eine andere Literaturgattung bevorzugte. „Krimis lese ich nur zur Entspannung!“ Schließlich müsse man sich gelegentlich von Her-mann Hesse, Elfriede Jelinek und Günter Grass erholen.
Mein Wunsch, mich an diesen Gesprächen zu beteiligen, war erheblich schwächer ausgeprägt als die Angst vor dem, was sich in diesem Wald am Hiltruper See tat. Hatte ich vor ein paar Minuten nicht einen Schrei gehört? Aber die Lehrerin hatte von einem Eichelhäher gesprochen, und vermutlich hatte sie Recht.
Dann aber sah ich, wie sich das Gesicht des Lehramtsanwär-ters, der unsere Gruppe leitete, plötzlich veränderte. Er krauste die Stirn, kniff die Augen zusammen, wirkte mit einem Mal sehr konzentriert und verlangsamte seinen Schritt. Die Bibliothekarin, die vergessen hatte, festes Schuhwerk einzupa-cken und deswegen ständig zu Boden blickte, um nicht auszurut-schen, wäre beinahe gegen ihn geprallt. Nun stand sie da, ki-cherte verlegen und erklärte ein weiteres Mal, welchem Umstand es zu verdanken war, dass sie mit Pumps durch den Wald stol-perte.
Ich folgte dem Blick des Lehramtsanwärters, der nun stehen geblieben war, und fror urplötzlich wie unter einem eiskalten Windstoß. Das Gebüsch, das er ungläubig betrachtete, erhob sich dunkel über einer Reihe kraftstrotzender Farne, die ihre Blätter in die Höhe reckten, als wäre es ihre Aufgabe, das Licht einzufangen, das spärlich durch die dichten Laubkronen brach. Hellgrün waren sie, die Farne, so hell wie kein anderes Grün in diesem Wald. Die Büsche dahinter wirkten finsterer, als sie wirklich waren, dichter und borstiger hinter dem federleichten Farn. Ihre Blätter waren beinahe so spitz wie Dornen und sehr spärlich, sodass die Zweige wie ein Skelett durchs abgemagerte Laub stachen.
Von dem Schuh war nur der vordere Teil zu sehen. Ein hell-brauner Wildlederschuh mit einer abgestoßenen Spitze. Sie hatte sich durch zwei Äste geschoben und ein paar schwache Farne zur Seite gedrängt. Obwohl nichts zu sehen war außer diesem Schuh, war mir auf der Stelle klar, dass es kein weggeworfener Schuh war, kein verlorener Schuh, kein Schuh, der wertlos und überflüssig geworden war. Kein Schuh, der allmählich verrotten würde, keiner, dessen Gegenstück vielleicht am Hiltruper See lag. Nein, das Gegenstück war ebenfalls hier. In diesem Gebüsch. Am anderen Fuß des Mannes, der auf dem Rücken lag, unter abgeknickten Zweigen, halb verdeckt von denen, die zu Boden gedrückt, aber dann wieder in die Höhe geschnellt waren, stark genug, um unter dem Gewicht des Mannes nicht zu brechen. Sie hatten sich über sein Gesicht gelegt, über seinen Brustkorb, seine Arme.
„Ich habe ihn gefunden“, kreischte die Bibliothekarin und lachte hysterisch. „Ich habe ihn als Erste gesehen.“
„Das ist doch egal“, sagte der Architekt ärgerlich. „Darauf kommt es nicht an.“
„Dafür gibt es keine Punkte“, bestätigte die Hausfrau. „Oder haben Sie die Spielregeln nicht gelesen?“
Der Rechtsanwalt, der mitsamt seiner Bürovorsteherin ange-reist war, begann zu lachen. „Verdammt gut geschminkt!“
„Ja, sieht total echt aus“, bekräftigte die Bürovorsteherin und wandte sich an den Lehramtsanwärter. „Und was müssen wir jetzt tun?“
„Darüber haben wir doch vorher gesprochen“, tadelte die Hausfrau. „Jetzt beginnt die Tatortarbeit.“
Sie blickte den Leiter unserer Gruppe an, als erwartete sie Lob und als hoffte sie darauf, als Erste zur Tat schreiten zu dürfen. Aber er verweigerte ihr sowohl das eine als auch das andere. Mit zitternden Fingern holte er sein Handy aus der Ja-ckentasche. „Verdammt, kein Netz!“, stöhnte er.
Auf allen Gesichtern erschien nun Überraschung und Ver-ständnislosigkeit, dann wurde in Sekundenschnelle Bestürzung daraus, Ungläubigkeit, Entsetzen. Möglich, dass ich die Einzige war, die so etwas wie Erlösung empfand. Gott sei Dank, nun wusste ich endlich, wovor ich Angst gehabt hatte! Nun war es heraus! Meine Vorahnung hatte Gestalt angenommen, sie war kein Schatten mehr, der sich vor einem tanzenden Licht tausendfach vergrößerte.
Weil ich als Einzige gewarnt gewesen war, fasste ich mich als Erste. „Ich laufe zum Hotel zurück und hole die Polizei!“, rief ich und rannte los, ehe mich jemand zurückhalten konnte. Wer mir übel wollte, hätte behaupten können, ich fürchtete mich vor dem toten Mann.
Es klingelte an der Tür. Genau in dem Augenblick, in dem Christophers Handy ging und Alexandra beschloss, mir zur Feier des Tages das Kaffeekochen abzunehmen. Mein Ehemann wandte sich gerade mit leutseligen Worten an meinen Geliebten, also blieb mir nichts anderes übrig, als selbst die Tür zu öffnen. Nicht, dass es mir etwas ausmachte, jemanden in die Wohnung zu bitten, den Paketboten abzufertigen oder einen Hausierer abzuweisen. Aber diesmal fühlte ich mich wie ein Kind, das den Nikolaus erwartete. Meine Vorahnungen begleiteten mich bis in die Diele. Stand da draußen jemand, der mit der Rute drohte?
Schlimmer! Vor mir stand eine Frau von Mitte sechzig und lächelte mich an. Sie war etwa so groß wie ich, neigte aber im Gegensatz zu mir zur Fülligkeit. Ihr Gesicht war rund und pausbäckig, blondierte Locken umrahmten es. Sie trug eine schwarze Hose, einen gewagten kunterbunten Blazer und darunter einen schwarzen Rolli. Eine gepflegte, durchaus attraktive Er-scheinung! Wenn mir ihr Alter nicht bekannt gewesen wäre, hätte ich sie höchstens für Ende fünfzig gehalten.
"Was ist das für ein merkwürdiges Schild neben der Tür?", fragte sie, wie sie mich früher gefragt hatte, warum mein Fahrrad himmelblau sein musste und mein rechter Daumennagel dunkelgrün. Ohne meine Antwort abzuwarten, wies sie auf den Koffer, der auf der Fußmatte statt. "Ruf bitte Ingo, damit er mir hilft." Während ich immer noch um Fassung rang, ging plötzlich ein Strahlen über ihr bis dahin angespanntes Gesicht. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Kind!"
Dann fand ich mich an der Brust meiner Mutter wieder. Seit fünf Jahren zum ersten Mal. Dass ich mich in ihrer Umarmung wohl fühlte, dass mir das Warme, Weiche noch immer gut tat und der Duft ihres Eau de Toilette nach wie vor Geborgenheit versprach, schockierte mich beinahe noch mehr als ihr unerwartetes Auftauchen. Was hatte sie sich dabei gedacht, sich mir wie eine böse Vorahnung zu nähern?
Meine Mutter machte einen Schritt zurück und betrachtete mich aus der Distanz, aus der ihr nichts entging. Ihr Blick war kritisch wie eh und je, das Strahlen hatte etwas Scharfes, Schnippisches bekommen. Ich fühlte mich gemaßregelt, noch bevor sie mir meinen unweiblichen kurzen Haarschnitt, meine skandalös enge Jeans und den freien Bauchnabel unter meinem knappen lila Pulli vorhalten konnte, und setzte schon zu Rechtfertigungen an, bevor mich ein Vorwurf treffen konnte.
Zum Glück ließ sie mich nicht zu Wort kommen. "Die Geburts-tagsüberraschung ist mir gelungen, was?"
Ich nickte, immer noch wie betäubt. "Du warst lange nicht mehr in Deutschland."
"Das wird sich ändern", entgegnete meine Mutter. "Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, was dieses Schild neben der Tür zu bedeuten hat."
Ich fühlte bereits wieder die alte Aufsässigkeit durch meine Glieder rieseln, diesen Wunsch nach Widerstand, der nie etwas anderes als einen rhetorischen Tiefschlag hervorgebracht hatte. Nichts, was auch nur das Geringste bewirken konnte. "Kannst du nicht lesen?", fragte ich so patzig wie ein pubertierendes Gör zurück. "Romy Schell - diskret und schnell! Münsters neue Privatdetektei! Ich bin seit ein paar Monaten eine berufstätige Frau."
Ich kam nicht weit. Nur fünf, sechs Schritte, und schon rutschte ich mit der rechten Ferse auf dem Moos aus, griff nach dem Ast einer Kiefer, der sich mir gütig anzubieten schien und mich dann hinterrücks zu Fall brachte, indem er mir mit seinen spitzen Nadeln ins Gesicht fuhr. Ich fiel hintenüber, mein Kopf landete in einem zum Glück weichen Bodendecker, meine Hände griffen in Brennnesseln, meine Beine wurde von dornigem Gesträuch aufgekratzt. Ich hatte mich noch nicht von meinem Schreck erholt, da wusste ich, dass ich so dalag wie der Tote ein paar Büsche weiter. Entsetzt riss ich die Augen auf, sah durch ein Loch in den Baumkronen in den hellgrauen Himmel und wurde von der Frage gelähmt, ob es das gewesen war, was der Tote in seinen letzten Augenblicken gesehen hatte: ein rundes Stück Himmel, von zitterndem Laub umkränzt.
Der Lehramtsanwärter, der unsere Gruppe in den Wald geführt hatte, war als Erster bei mir. „Um Himmels willen! Haben Sie sich verletzt?“ Er griff nach meinen Händen, ließ sie aber schnell wieder los, als er mit den ersten Brennnesseln Kontakt aufgenommen hatte. „Sie sind ja ganz aufgeregt.“
Sein mitleidiger Blick trieb mich in die Höhe. Ohne auf meine brennenden Hände Rücksicht zu nehmen, griff ich in meine Jackentasche. „Ich bin nicht aufgeregt, sondern ausgerutscht“, erklärte ich so blasiert, wie es mir eben möglich war.
„Am besten, ich laufe zurück und rufe die Polizei an!“, hörte ich den Architekten sagen.
Ich holte meine Visitenkarte hervor, die mein ganzer Stolz war und ohne die ich daher selten das Haus verließ. „Sie sollten mich das machen lassen.“ Meine Stimme war nun stabil, ich konnte ruhig sprechen und dabei eine gewisse Überlegenheit ausstrahlen. Mit großer Geste rückte ich meine Visitenkarte ins rechte Licht. „Ich bin Privatdetektivin und habe gute Kontakte zur Polizei. Wenn ich bei der Kripo anrufen, geht das ruck-zuck.“
Dem Architekten fiel zu meiner großen Freude die Kinnlade herunter, während der Reiseleiter verärgert die Stirn runzelte. „Was macht ein Detektivin in unserer Gruppe?“, fragte er leise, schien aber keine Antwort zu erwarten.
Die Dortmunder Hausfrau wies mit dem Zeigefinger auf mich. „Haben wir diese Privatdetektivin auch gebucht?“, fragte sie.
Ich überließ es dem Anführer unserer Gruppe, ihr zu erklä-ren, dass sie zwar für eine Leiche gezahlt hatte, dass sich das Wochenende aber dennoch anders gestalten würde, als es der Prospekt versprochen hatte. Mit großen Schritten entfernte ich mich von der Gruppe und achtete dabei streng darauf, einen si-cheren, tatkräftigen Eindruck zu machen. Erst, als ich außer Sichtweite war, begann ich wieder zu laufen. Blindlings in den Wald hinein, als wäre der Mörder hinter mir her, als sollte ich das nächste Opfer sein. Nicht wie eine routinierte, beherrschte Privatdetektivin, die genau weiß, was zu tun ist, wenn sie einem Mordopfer gegenübersteht.
Schwer atmend blieb ich stehen. Mordopfer? Wie kam ich zu der Gewissheit, dass dieser Mann ermordet worden war? Er konnte genauso gut eines natürlichen Todes gestorben sein. Vielleicht war er gestürzt und hatte sich tödlich verletzt. Oder er hatte einen Herzinfarkt erlitten, mitten im einsamen Wald, wo ihm niemand helfen konnte. Ein Pilzesammler vielleicht oder jemand, der seine Frau mit selbst gepflückten Brombeeren überraschen wollte.
Ich fühlte, dass ich den Kopf schüttelte, um mich selbst zu überzeugen. Nein, ich war sicher, dass dieser Mann ermordet worden war. Ich hatte doch vorher auch gefühlt, dass etwas Schreckliches geschehen würde. Ich hatte Geräusche gehört, Schatten gesehen und gespürt, wie das Unheil durch den Wald geweht war. Wie ein beklemmender Föhn, der mehr als nur einen Wetterumschwung ankündigte.
Wieder begann ich zu laufen. Ich hörte Stimmen, anscheinend hielt ich auf einen der vielen Wege zu, die um den Hiltruper See führten. Selbst, wenn ich nicht auf den zurückfand, den unsere Reisegruppe gegangen war, würde ich das Hotel bald erreichen. Um den Hiltruper See herum führten alle Wege zum Hotel Krautkrämer.
Ich warf einen Blick auf mein Handy. Immer noch kein Netz! Aber die Stimmen kamen näher. Und niemand würde später erfahren, dass ich wie eine unkundige Touristin nach dem Weg zum Hotel gefragt hatte, statt mich wie eine beherzte Detektivin nach der Himmelsrichtung zu orientieren oder einfach dem siebten Sinn zu vertrauen, der einer Privatdetektivin angeboren sein sollte.
Es war ein schrecklicher Moment, als ich die Stimme des Lehramtsanwärters erkannte, eine schmerzhafte Niederlage, die sichere Erkenntnis, komplett versagt zu haben.
„Nichts anfassen!“, hörte ich ihn rufen. „Frau Schell muss jeden Moment mit der Kripo zurückkommen.“
Die Scham machte mich für ein paar Augenblicke schwach. Dann war aus der Schwäche ein solcher Schmerz geworden, dass sie mir die Kraft gab, vor ihr zu fliehen, mich unhörbar zurückzuziehen. Dass nur niemand merkte, was mir passiert war!
Vorsichtig schlich ich rückwärts. Nur leises Knacken unter meinen Füßen, kaum wahrnehmbares Rascheln. Dann drehte ich mich um. Die Gummisohlen meiner Schuhe erzeugten ein ryhtmisches Saugen, aber es schien nicht zu der Reisegruppe vorzudringen, die sich vermutlich auf nichts als auf den toten Mann konzentrierte. Ich wurde immer hastiger, immer unvorsichtiger, je weiter ich mich von der Gruppe und von der Gefahr entfernte, als untaugliche Detektivin entlarvt zu werden. Das Rascheln, Knistern und Knacken, das meine flüchtenden Schritte erzeugte, wurde immer lauter, ich wurde immer leichtsinniger. War es so auch dem Mörder ergangen? Hatte er es zunächst geschafft, zu einem Schatten zu werden, als er merkte, dass er nicht allein im Wald war? Und war er dann mit jedem Meter, den er flüchtete, unvorsichtiger geworden? Sehnsucht machte leichtsinnig, das konnte ich in diesem Augenblick nachempfinden. Egal, ob die Sehnsucht ein gutes oder ein böses Ziel hatte.
Als ich sicher sein konnte, dass mir die Flucht gelungen war, erlaubte ich mir sogar, laut aufzustöhnen. Ich musste mich zur Ruhe zwingen. Wenn ich ab jetzt alles richtig machte, würde niemand merken, dass ich im Kreis gelaufen war. Noch waren ja nur wenige Minuten vergangen.
Aufmerksam sah ich mich um, blickte hoch in das Dach des Waldes. Wo wurde es lichter? Wo öffneten sich die noch dicht belaubten Baumkronen für den Hiltruper See? Ich tastete mich vorwärts, orientierte mich immer wieder nach hinten, um sicher zu gehen, dass die Stimmen, die gelegentlich noch zu hören wa-ren, in meinen Rücken trafen, dass mein Abstand zu ihnen keine Diagonale wurde oder gar ein rechter Winkel. Immer wieder sah ich in die Baumkronen, dann wurde ich sicherer. Ich musste nur endlich einen Weg erreichen, dann würde ich schneller voran-kommen. Dieses Stapfen über hohe Farne hinweg verschlang viel zu viel Zeit.
Dann erreichte ich ein Stück besonders dunklen Kiefernwaldes mit einem braunen, nadelübersäten Boden, auf dem leicht zu laufen war. Dahinter wieder ein Streifen Laubwald mit weit auseinander stehenden Bäumen, zwischen denen es hell schimmerte. Der Hiltruper See!
Erleichtert sprang ich über einen hohen Bodendecker, drängte mit der Rechten einen Busch beiseite – und blieb wie angenagelt stehen. Vor mir ein paar Quadratmeter finsterer Waldboden, zu meiner Rechten ein struppiges Gebüsch. Aus ihm ragten zwei Beine. Sie steckten in Bluejeans, aus ihnen sahen dunkelrote Stiefeletten heraus. Mir war, als hörte der Wind auf, mit dem Laub zu rascheln, als gäbe in diesem Augenblick kein Vogel einen Laut von sich. Die Welt um mich herum erstarrte für zwei, drei Sekunden, die so lang waren wie die Ewigkeit. Ich wagte mich erst ein paar Schritte vorwärts, als ich den Wind wieder hören konnte, als ein Vogel rief und ein Insekt an mir vorbeisummte. Noch zwei Schritte, dann sah ich eine braune Windjacke, zwei weitere, und ich konnte die hellen Handflächen der Frau erkennen. Ihre Arme waren zur Seite gefallen, die Handflächen wiesen zum Himmel. Ihr Gesicht neigte sich zur Seite, dunkle glatte Haare waren darüber gefallen, eine Strähne lag auf ihren Lippen. Ihre Augen waren geschlossen. Über ihrer Gestalt lag die Kälte des Todes.
Der Mittwoch hatte seinen Lauf genommen. Irgendwann spielte ich nicht mehr die Hauptrolle, nicht mal eine Nebenrolle, fürs Erste musste ich mich sogar mit einer Beschäftigung als Statist begnügen.
"Lydia!" Ingo hatte die Stimme seiner Schwiegermutter er-kannt und kam in die Diele gelaufen. Verdrießlich sah ich zu, wie die beiden sich in die Arme fielen und sich aufführten wie die Helden in einer tragischen Liebesgeschichte.
"Warum hast du mich nie auf Mallorca besucht?", fragte meine Mutter. Während sie mir diese Frage stets entgegengequengelt hatte, lächelte sie Ingo an, als hätte sie ihm kein Versäumnis vorgehalten, sondern ihn um ein Glas Sekt gebeten.
"Darauf müssen wir mit einem Glas Sekt anstoßen!", rief In-go, der damit mal wieder bewies, dass er und seine Schwieger-mutter ein Herz und eine Seele waren. "Nicht nur, weil deine Tochter heute Geburtstag hat, sondern vor allem, weil wir dich nach fünf Jahren endlich wieder sehen."
"Romy wollte mich ja nie auf Mallorca besuchen", nörgelte meiner Mutter prompt.
Ingo nahm ihren Arm und führte sie in Richtung Wohnzimmer. "Du weißt ja, Romy hat Gerhard nie leiden können."
Dass es ihm selbst nicht anders ergangen war, unterschlug er kurzerhand. Nein, der heiß geliebte Schwiegersohn sorgte dafür, dass an seiner Stellung in Muttis Herzen nicht gerüttelt wurde.
Die Kinder hatten nun auch begriffen, welcher Besuch ins Haus geschneit war. Mit ungläubigen Augen erschienen sie in der Wohnzimmertür. "Omi?"
Zwei Minuten später strahlte meine Mutter übers ganze Ge-sicht. War die Begrüßung ihrer Tochter ein wenig verhalten ausgefallen, die Begeisterung ihres Schwiegersohnes und ihrer Enkelkinder machte alles wieder wett. Ihr Strahlen schrumpfte erst in sich zusammen, als sie das Wohnzimmer betrat und dort einen fremden Mann im Sofa vorfand.
"Darf ich dir meinen Geliebten vorstellen?", fragte ich provokant und spürte dieselbe diebische Freude in mir, die ich immer empfunden hatte, wenn es mir gelungen war, meine Mutter aus der Fassung zu bringen. Diesen Sport trieb ich seit meiner Pubertät und hatte meine Leistungen in jeder Disziplin von Jahr zu Jahr gesteigert. Heute wie damals sagte ich mir, dass meine Mutter selber schuld war. Ihre strenge Auffassung von dem, was eine Frau zu tun und zu lassen hatte, und von dem, was Männern zugestanden und nachgesehen werden musste, hätte sogar ein Stiftsfräulein zum Widerstand gereizt.
Amüsiert beobachtete ich, wie ihr Gesicht lang und länger wurde, als Maximilian sich langsam erhob und ein paar Schritte auf sie zumachte. Alle anderen schienen den Atem anzuhalten, denn es wurde plötzlich mucksmäuschenstill im Raum.
Maximilian schien zu ahnen, dass es besser war, auf einen Händedruck zu verzichten. Meine Mutter sah aus, als wäre sie zu kraftlos, ihm ihre Hand entgegenzuhalten. So verbeugte er sich nur knapp vor ihr und nannte seinen Namen. "Schön, Sie kennen zu lernen."
Dass von meiner Mutter kein freundliches "Ganz meinerseits" zu erwarten war, überraschte ihn nicht. Er durchschaute sie ohne weiteres, obwohl er sie zum ersten Mal in seinem Leben sah! Aber um ihre entgeisterte Miene zu analysieren, brauchte man wahrlich kein Psychoanalytiker zu sein. Meine Mutter stand da und schnappte nach Luft.
"Geliebter?", stieß sie hervor, gerade als ich anfing, mir um ihren Gesundheitszustand Sorgen zu machen. "Was willst du damit sagen, Romy?"
"Dass Ingo sich rein zufällig in dieser Wohnung aufhält. Eigentlich wohnt er am Yorkring in einem eigenen Apartment."
Meine Mutter griff nach einer Sessellehne, um sich Halt zu verschaffen. "Ihr seid geschieden? Und niemand hat es für nötig gehalten, mir das mitzuteilen?"
"Wir leben getrennt", korrigierte ich und ergänzte, als ich den Blick auffing, den meine Mutter dem armen Maximilian zuwarf: "Aber nicht, weil ich einen Geliebten habe, sondern weil Ingo vor ein paar Monaten zu seiner Freundin gezogen ist."
"Ein schrecklicher Fehler", erklärte Ingo prompt und verlieh seinem Gesicht einen schmerzlichen Ausdruck. "Wie gerne würde ich alles wieder gutmachen. Aber Romy lässt mich leider nicht."
Wie nicht anders zu erwarten war, stellte Alexandra sich umgehend an Ingos Seite. "Dabei haben Chris und ich solche Sehnsucht nach Papa."
"Das hat Papa gar nichts ausgemacht, als er zu Sandra zog", kam da die Stimme meines Sohnes, den ich für diese Unterstützung gerne umarmt und geküsst hätte.
"Deswegen war ich übrigens gezwungen, einen Beruf zu er-greifen", ergänzte ich hinterlistig und fand, dass mit dieser Bemerkung ein wichtiger Punkt an mich ging.
Aber kurz darauf beschämte mich mein Sohn zutiefst, der be-wies, dass er der Charakterstärkste der Familie war. Während ich mir noch heimlich die Hände rieb und Alexandra und Ingo schon ansetzen wollten, meinen Beruf in einem ganz anderen Licht darzustellen, bedachte Christopher uns alle mit einem vorwurfsvollen Blick und sagte: "Hört auf damit! Lasst uns lieber überlegen, wo Omi schlafen soll."
Sein Ablenkungsmanöver war gelungen! "Du willst bei uns ü-bernachten?", fragte ich erschrocken.
Meine Mutter sah mich nun genauso vorwurfsvoll an wie Christopher. "Soll ich etwa heute Abend wieder nach Hamburg zurückfahren?"
"Wieso Hamburg?", fragte ich verwirrt. "Sonst bist du immer in Düsseldorf gelandet."
"Wie kommst du darauf, dass ich aus Palma komme? Ich wohne nicht mehr auf Mallorca, sondern in Hamburg. Schon seit zwei Wochen."
"Ich geh' dann mal", sagte Maximilian leise, den ich total vergessen hatte.
Ich griff nach seinem Arm und zog ihn aus dem Wohnzimmer, damit er nicht der Versuchung erlag, meiner Mutter doch noch die Hand reichen zu wollen und seine höflichen Worte an einer Salzsäule abprallen zu lassen.
"Wie lange wird sie bleiben?", flüsterte er mir an der Woh-nungstür zu.
Ich hob unglücklich die Schultern und ließ sie noch un-glücklicher wieder fallen.
"Können wir das Wochenende zusammen verbringen?", fragte Maximilian hoffnungsvoll. "Ich würde gerne deinen Geburtstag noch einmal feiern. Nur wir beide."
"Das wäre schön, aber es geht nicht."
"Warum nicht? Ich habe natürlich noch ein anderes Geschenk für dich. Nicht nur die Blumen. Etwas, was ich nicht in Gegen-wart deiner Kinder überreichen möchte."
"Oh, Maximilian!" Dass er gerade in diesem Augenblick wieder aussah wie der verehrungswürdige Hugh Grant, machte alles noch schwerer. Außerdem wusste ich wieder, warum ich Überra-schungsbesuche nicht leiden konnte und warum ich speziell auf diesen gern mindestens zwei Wochen vorbereitet gewesen wäre. Das Auftauchen meiner Mutter hatte bisher immer für Konflikte gesorgt. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass es diesmal anders sein würde.
In Windeseile erzählte ich ihm, dass ich das nächste Wo-chenende am Hiltruper See verbringen würde. „Ein Geburtstags-geschenk der Kinder. Ich erzähle dir bei nächster Gelegenheit mehr darüber.“
„Das ganze Wochenende?“ staunte Maximilian. „Auch die Näch-te?“
„Nein, die nicht.“
„Aber dann könntest du doch..."
Ich unterbrach ihn, indem ich die Tür öffnete und ihn aus der Wohnung schob. "Erst mal sehen, wie lange meine Mutter bleibt. Wenn sie am Wochenende noch da ist, muss ich mich um sie kümmern."
Das sah Maximilian ein. Er war ein Mann, der alles einsah, was ihm überzeugend dargelegt wurde. Ob es daran lag, dass er Jurist war? Nein, vor allem lag es daran, dass er ein großar-tiger Mann war, der mich liebte. Attraktiv wie Hugh Grant, liebenswert, zärtlich, treu... einfach so, dass ich mich auf den ersten Blick in ihn verlieben musste und heute immer noch in ihn verliebt war. Unter anderem liebte ich ihn dafür, dass er geduldig Alexandras Ablehnung und Ingos häufige Anwesenheit ertrug und nun auch den Besuch und die todsichere Zurückweisung meiner Mutter ertragen musste. Dass er auch sie aushalten würde, daran hatte ich keine Zweifel.
Er streckte den Kopf noch einmal in die Wohnung, um mich zu küssen. Ich genoss diese kurze Zärtlichkeit ganz besonders, weil ich wusste, dass meine Mutter sie schwer missbilligen würde. So, wie ich es im Alter von vierzehn Jahren genossen hatte, von einem älteren Schüler geküsst zu werden, der mir Nachhilfe in Mathe geben sollte und dem meine Mutter voll und ganz vertraute. Dass sich meine Leistungen im Fach Mathematik nur sehr geringfügig verbesserten, hatte sie niemals meinem Nachhilfelehrer angelastet. Damals war ich heilfroh gewesen, dass sie mich nicht durchschaute, heute war ich heilfroh, dass es mir nichts ausmachte, von ihr durchschaut zu werden. Als ich die Tür hinter Maximilian schloss, hoffte ich inständig, dass ich mir nichts vormachte.
Als ich ins Wohnzimmer kam, goss Ingo gerade den Sekt ein, und die Kinder präsentierten ihrer Großmutter das jüngste Mit-glied der Familie Schell, einen Papagei namens Humphrey. Meine Mutter kannte ihn noch aus der Zeit, in der er bei meiner Pa-tentante gelebt hatte.
"Wie konntest du dieses schreckliche Erbe annehmen?", seufzte sie. "Dieser Papagei war immer schon genauso schamlos wie meine Schwägerin."
"Ich bin froh, dass ich Humphrey geerbt habe", lächelte ich und verschonte meine Mutter nicht mit den Einzelheiten. "Wenn Tante Almut mir nicht ihren Papagei vermacht hätte, hätte ich niemals Maximilian kennen gelernt. Er ist nämlich der Rechts-anwalt, der mir mein Erbe aushändigen musste. Und er ist sogar verpflichtet, regelmäßig nach Humphrey zu sehen und zu kon-trollieren, ob es ihm gut geht. Das hat Tante Almut in ihrem Testament so verfügt. Nur solange Humphrey lebt, bekomme ich die Rente aus ihrem Nachlass."
Meine Mutter schüttelte verächtlich den Kopf. "Almut war zu Lebzeiten eine unmögliche Person. Ich möchte nicht wissen, wie viele Liebhaber sie gehabt hat. Kein Wunder, dass sie nicht alt geworden ist."
Humphrey legte den Kopf schräg und sah meine Mutter auf-merksam an. Er liebte jede Art von Zuwendung und beteiligte sich gerne an den Gesprächen, die in der Nähe seines Käfigs geführt wurden.
"Hurensohn!", krächzte er. "Gottverdammter Hurensohn!"