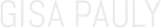REIF FÜR DIE INSEL | EINE SYLT-GESCHICHTE
Verlag | Rütten & Loenig (Aufbau-Verlag)
Erscheinungsdatum | März 2008
LESEPROBE:
Warum ausgerechnet Sylt? Warum Westerland? Kann es nicht Hamburg, München oder Düsseldorf sein? Er muss verrückt geworden sein! In einer Großstadt wäre sein Plan viel leichter in die Tat umzusetzen! Aber nein, er musste sich ausgerechnet für Sylt entscheiden! Für eine Insel, von der man nicht einfach fliehen kann - hinters Steuer, auf die Autobahn, Fuß aufs Gas und weg. Und das Schlimme ist, er weiß genau, warum er es getan hat. Er kann sich nichts vormachen, alles hängt irgendwie mit Sylt zusammen. Das, was in den vergangenen vierzig Jahren geschehen ist, und erst recht das, was nun geschehen wird. Also ist es doch richtig, dass er sich für Sylt entschieden hat?
Ja, es muss wohl so sein. Alles ist richtig. Auch die Fahrt über den Hindenburgdamm ist genau richtig für jemanden, der sich so schwer vom Festland löst wie Paul, der sich so ängstlich auf diese Insel zubewegt wie er. Der Hindenburgdamm ist besser als eine Flugroute, sogar besser als ein Wasserweg. Die Fahrt mit dem Auto, wenn es auch auf einem Waggon steht, hinter dem Steuer, wenn auch das Lenkradschloss eingerastet ist, erscheint wohltuend normal. Und dass das Navigationssystem durchdreht und sinnlose Anweisungen gibt, amüsiert ihn. Warum sitzt er eigentlich so aufrecht und steif da, als wäre er selbst und nicht der Lokführer für die sichere Fahrt nach Sylt verantwortlich? Eine lange Autofahrt hat er hinter sich. Zeit, während der halben Stunde auf dem Autozug ein Nickerchen zu halten.
Paul tastet an der linken Seite des Fahrersitzes entlang, wo es mehrere Tasten und Hebel gibt. Fast ein Jahr besitzt er dieses Auto nun, und noch immer weiß er nicht, wie sich die Rückenlehne verstellen lässt. Erster Versuch - der Sitz schießt nach hinten, zweiter Versuch - die Sitzfläche neigt sich, dritter Versuch - die Rückenlehne schlägt ihm in den Nacken. Sie mit der gleichen Taste wieder nach hinten zu neigen, gelingt ihm erst, nachdem er versehentlich den Fensterheber betätigt hat. Der scharfe Wind greift mit langen, spitzen Fingern ins Wageninnere, nimmt sich, was er zu fassen bekommt, reißt an sich, was nicht niet- und nagelfest ist. Zum Beispiel die kleinen Notizzettel, die Paul in die Ritzen der Klimaanlage gesteckt hat. Zu blöde aber auch, dass er als erstes in sein schütteres Haar greift, das keine Unordnung verträgt, wenn der Schein, der durch aufwändiges Föhnen erreicht worden ist, erhalten bleiben soll. Um seine Haarpracht hätte er sich später kümmern können, für einen der Notizzettel kommt diese Erkenntnis zu spät. Er wird aus dem Fenster gerissen, steht für ein paar Augenblicke auf der Spitze eines Wirbels, flattert dann aufgeregt von einem Auto zum anderen, kollidiert mit einer Antenne und erhält, nachdem er sie einmal umrundet hat, den Schwung, der ihn den Möwen nachschickt.
Paul stöhnt auf und lehnt sich zurück. Vielleicht wird in zwei, drei Tagen alles anders sein. Möglicherweise sucht er dann gerade nach dem Gedanken, den er auf dem Zettel notiert hat, oder aber es kommt auf diesen Gedanken nicht mehr an. Er blickt einer Möwe nach, die dem Sylt-Shuttle vorausfliegt, und begreift, dass er ihr folgen muss, dass es keine Rückkehr geben wird. Die Entscheidung ist gefallen. Wie oft hatte er sich geschworen, es auf keinen Fall zu tun. Niemals! Warum diesmal? Weil sich sein Leben ändern soll nach der Scheidung? Weil Uschi sowieso nicht mehr dicht halten wird?
Pauls Augen wandern übers Watt. Wie friedlich es daliegt! Selbst jetzt, wo der frische Wind die Oberfläche aufreibt, sodass sie rau wird und Kälte spiegelt. Seinen Frieden verliert das Watt trotzdem nicht. Das Wasser steigt, mittlerweile ist ein großer See entstanden, der den Himmel aufsaugt. Ja, es liegt wohl an Sylt.
Ich besitze ein Ferienhaus. Ein reetgedecktes Ferienhaus auf Sylt. Das ist doch schon was! Ich will jetzt an nichts anderes denken. Nicht an das, was ich verloren habe, sondern an das, was ich gottlob noch habe.
Elena sagt, ich wäre dumm. „Du kannst viel mehr rausschlagen. Für das, was er dir angetan hat, muss er zahlen.“
Was hat er mir denn angetan? Ich kann nun tun und lassen, was ich will, und mir gehört ein Haus auf Sylt! Ich finde, das reicht. Soll Georg doch glücklich damit werden, dass er eine zwanzig Jahre Jüngere neben sich hat. Soll er doch stolz darauf sein, dass eine Frau ihn attraktiv findet, die beinahe seine Tochter sein könnte! Schorsch nennt sie ihn. Und er grinst dann, als wäre er ein Doppelgänger von George Clooney. Seinen Bauch sieht sie anscheinend nicht, die grauen Haare, die Halbglatze, die Tränensäcke auch nicht.
„Ist doch klar“, ereifert sich Elena. „Sie sieht nur sein Geld. Hättest du dafür gesorgt, dass er keins mehr hat, würde sie jetzt nicht auf Heirat drängen.“
Aber was geht mich das an? Gar nichts! Zum Glück! Wütend macht mich nur, dass ich die Alleinherrschaft über dieses Ferienhaus einem Klischee verdanke. Ausgerechnet eine Jüngere und ausgerechnet seine Sekretärin! Wer hätte gedacht, dass mein Leben mal einem Groschenroman ähneln wird? Und dass ich beim Happyend nicht mehr dabei sein werde!
Fenster auf und kräftig durchlüften! Klischees stecken voller Mief. Raus mit ihnen! Warum denkt man beim Happyend eigentlich immer an zwei Menschen, an Mann und Frau? Am Ende einer dreißigjährigen Ehe kann man auch allein ziemlich happy sein. Gerade dann! Ein Happyend ganz für mich allein! Eigentlich gar nicht schlecht.
"Moin, moin!"
Ja, begafft sie ruhig, die schönen Ferienhäuser in Braderup. Dieses Haus gehört mir. Mir ganz allein! Da staunt ihr, was?
Plötzlich würde er doch gerne an der Reling eines Schiffes stehen und der Insel entgegenblicken, die Häuser zu sich heranwachsen sehen und beobachten, wie die Menschen Gestalt annehmen. Auf die Insel zufahren, statt sie sich stückweise präsentieren zu lassen, jedes Stück so groß und rechteckig wie die Windschutzscheibe seines Autos.
Paul konzentriert sich nun auf das Watt, blickt konsequent durch die Seitenscheibe. Der Insel wird er sich erst stellen, wenn er sie erreicht hat. Dieser Insel, die sein Leben verändert hat, dieser Insel, der er die Zähne zeigen wird. Ich kann auch anders, Sylt! Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Wirst dich wundern. Ihr alle werdet euch wundern.
Das seichte Wasser, das auf dem Wattboden steht, hat die gleiche Farbe wie der Himmel. Es ist, als flösse er ins Wattenmeer oder als stiege das Meer in den Himmel auf. Gewaltig ist das Bild, das der Zug durchschneidet, so riesig, dass sich in Paul zwei Empfindungen umkreisen und belauern. Freiheit ist die eine, Verlorenheit die andere. Klein fühlt er sich angesichts dieser Dimension, aber auch groß als ein Teil von ihr. Und nur daran will er denken! Nie wieder wird er sich klein machen lassen. Hat er das nötig? Nein, hat er nicht!
Als Sechzehnjähriger hat er nichts von den Dimensionen gespürt. Er war mit seiner Clique nach Sylt gefahren, um etwas zu erleben. Und vor allem deshalb war er nach Sylt gefahren, weil auch Sophia mitkommen wollte. Sophia mit den großen grauen Augen und dem frechen Pferdeschwanz. Wenn sie verlegen war, griff sie sich an den Hinterkopf und korrigierte den Sitz ihres Haargummis, wenn sie lachte, schlug sie die Hand vor den Mund, als schämte sie sich der Lücke zwischen ihren Vorderzähnen. Paul fand diese Lücke wunderhübsch. Als sie nach Sylt aufbrachen, trug sie eine himmelblaue Hosen, auf die sie Hippie-Blüten gemalt hatte, und einen sehr knappen Pulli, der erst nach der Abreise unter einer weiten Jacke zum Vorschein kam. Sophias Eltern waren wahrscheinlich schon an der engen Hose ihrer Tochter verzweifelt, der Pulli hätte womöglich zu einer Stornierung der Reise geführt.
Sie hatten das Abteil verlassen und waren auf den Gang hinausgetreten. „Mal eben eine Fluppe rauchen.“
Solche Sätze tun gut, wenn man sechzehn ist. Vor vierzig Jahren erst recht, als es noch viel länger dauerte, erwachsen zu werden und es viel wichtiger war, als erwachsen zu gelten. Wenn man sich ans offene Fenster eines Zuges stellte und eine Fluppe rauchte, dann war man erwachsen, ganz klar, auch wenn man wie Paul keine Nietenhosen besaß, sondern in der Cordhose des älteren Bruders nach Sylt fuhr. Werner war sogar in einer rotkarierten Glockenhose zum Bahnhof gekommen und von allen beneidet worden. Werner musste sehr liberale Eltern haben, wenn sie ihren Sohn in Glockenhosen herumlaufen ließen. Vor allem die Väter hielten ihre Söhne für unmännlich, die diese bunten weiten Hosen trugen. Aber vermutlich waren Werners Eltern gar nicht liberal, sondern einfach nicht gefragt worden. Wer sich die Meinungen seiner Eltern anhörte, war ja schon hoffnungslos bürgerlich. Und bürgerlich genannt zu werden, war eine richtige Schande.
Die letzte Klassenfahrt hatte nach London geführt, und in der Carnaby-Street war viel Taschengeld auf den Kopf gehauen worden. Paul war schon froh gewesen, dass er überhaupt mitkommen konnte. Neidlos hatte er zusehen können, wie die anderen sich dort als Hippies verkleideten, sich mit Parkas eindeckten, an die sie Hammer-und-Sichel-Buttons steckten, und mit Blumen bemalte T-Shirts kauften. Das Einzige, was Paul sich leisten konnte, waren lange Haare. Und er war entschlossen, sich einen richtigen Wolf-Biermann-Schnauzer wachsen zu lassen, wenn er sicher sein konnte, dass daraus mehr wurde als ein dünnes Oberlippen-Bärtchen. Aber Paul litt nicht unter seinen beschränkten finanziellen Möglichkeiten. Was seine Klassenkameraden so wichtig fanden, interessierte ihn sowieso nicht. Er stimmte zwar ein, wenn sie schrieen „Bürger, kommt auf den Balkon, unterstützt den Vietcong!“, aber im Grunde wolle er nichts mit diesem lauten Protest zu tun haben. Paul war ein Mensch der leisen Töne, und er misstraute dem Geschrei der Freunde, die plötzlich Klassenkämpfer heißen wollten. Eigentlich wollten sie damit ja auch nur erwachsen werden, so wie Paul mit der Fluppe.
„Ich habe ein Geschenk für dich“, sagte er, als er endlich eine lässige Haltung gefunden hatte, den rechten Ellbogen auf die obere Kante des zur Hälfte heruntergelassenen Fensters gelehnt, in der linken Hand die Zigarette.
Es gefiel ihm, dass Sophia rot wurde, das machte seine eigene Verlegenheit erträglicher. „Du sollst kein Geld für mich ausgeben“, sagte sie und pustete den Zigarettenrauch von sich, ohne ihn inhaliert zu haben. „Ich weiß doch, dass du Zeitungen austragen musstest für die Fahrt nach Sylt.“
Paul schüttelte den Kopf. „Es hat nichts gekostet.“
Sophia sah ihn erstaunt an. „Du hast etwas gebastelt?“
Paul lachte. „So ähnlich.“
„Wann gibst du es mir?“
„Wenn wir allein sind.“
Er konnte ihren großen fragenden Augen nicht standhalten, drehte sich zum Fenster und sah hinaus. Wie hatte das Watt damals ausgesehen? War Ebbe oder Flut gewesen? Hatten die Muscheln unter der Sonne geglitzert, die Wattwürmer ihre Spiralen in den Schlick gedreht? Oder hatte sich bereits dieser glatte See gebildet, der sich jetzt vor seinen Augen ausbreitet? Paul kann sich nicht erinnern. Er hat ja nur aus dem Fenster geblickt, um Sophia nicht ansehen zu müssen. Nun war es heraus! Er hatte ihr gesagt, was er schon lange sagen wollte, hatte den ersten Schritt getan, auf den der nächste folgen musste. Es gab kein Zurück mehr, und das war gut so. Endlich würde er den Mut haben, ihr sein Geschenk zu präsentieren.
„Irgendwann werden wir ja mal allein sein können“, fügte er an und schnippte die Zigarette aus dem Fenster. Das hatte er oft geübt, und diesmal gelang es ihm richtig gut. Er nahm Sophia, die sich nach einem Aschenbecher umsah, die Zigarette ab und schnippte sie ebenfalls aus dem Fenster. Auch diesmal gelang es ihm hervorragend.
„Lass dich überraschen“, sagte er und wusste, dass es unglaublich lässig klang. Cool, würde man heute sagen, aber damals gab es dieses Wort nur im Englischunterricht. Nein, Paul war lässig, als er Sophia zurück ins Abteil schob. Er schaffte es sogar, Uschis Blick zu erwidern, ohne etwas zu sagen, was sich wie eine Entschuldigung angehört hätte.
Uschi schien zu spüren, dass Paul und Sophia durch eine Erwartung miteinander verbunden wurden. Soll sie doch, dachte Paul, sie kann nichts von mir verlangen, nur weil ich einmal schwach geworden bin. Trotzdem ärgerte er sich jetzt, dass er ihr ein Geheimnis verraten hatte: Die Beatles interessierten ihn nicht sonderlich und Bob Dylan auch nicht. Aus Sport machte er sich nicht viel, obwohl alle anderen es glaubten, weil er gut schwimmen konnte und sogar Rettungsschwimmer geworden war. Nein, dass Uschi wusste, womit er sich am liebsten beschäftigte, gab ihr nicht das Recht, danach zu greifen. Hatte sie ihm etwas vorgesungen, als sie behauptete, die Texte aller Lieder von Esther und Abi Ofarim zu kennen? Na, also!
Paul ließ sich in seinen Sitz fallen und zwinkerte Sophia zu, ohne sich darum zu kümmern, dass Uschi die Lippen aufeinander presste und aus dem Fenster starrte. Dann sah er Werner triumphierend an. Von wegen, Mädchen freuen sich über Kinokarten, Hippie-Blütenkränze oder Schallplatten! Einfallslos, solche Geschenke! Langweilig und banal! Was er Sophia schenken würde, war etwas ganz Besonderes, etwas, was sie niemals von einem anderen bekommen hatte. Danach würde er sie küssen dürfen, ganz sicher. Und dann würde er sie fragen, ob sie mit ihm gehen wollte. Paul lächelte Sophia an, als hätte sie bereits Ja gesagt. Und sie lächelt zurück, als hätte er sie längst gefragt. Es war nicht mehr wichtig, dass er sich derart lässig in den Sitz geworfen und derart lässig die Beine von sich gestreckt hatte, dass er in den Gang rutschte, als Bärbel nach ihrer Tasche griff und damit seinen Füßen den Widerstand nahm. Seine Freunde lachten, wie sie immer lachten, wenn Paul mal wieder Opfer seiner eigenen Gliedmaße geworden war. Längst nicht mehr hämisch oder schadenfroh, sondern gutmütig und nachsichtig. Paul ließ sich von ihnen in die Höhe ziehen und sah in Sophias lachendes Gesicht. Ja, es würde ihr gefallen, dass er nicht zu denen gehörte, die Kinokarten und Schallplatten verschenkten.
Sind alle Fenster geschlossen? Alle Türen? Früher hat Georg darauf geachtet. Ich habe nie Angst gehabt vor Einbrechern und Dieben. In Braderup ist alles so friedlich, ruhiger als in Westerland und nicht so prahlerisch wie in Kampen. Ich habe mich hier immer sicher gefühlt. Hat Georg etwa einen Teil meiner Sorglosigkeit mitgenommen? Muss wohl so sein. Warum sonst drücke ich jede Klinke herab, ehe ich sicher sein kann, dass mein Haus gut verschlossen ist? Meine Sicherheit ein Teil des Zugewinns? Unglaublich, wie wenig einem nach dreißig Jahren Ehe ganz allein gehört. Darüber darf ich mit Elena nicht reden. Sie würde mir nur ein weiteres Mal vorhalten, dass ich viel zu wenig für mein Glück getan habe. Elena hat drei Ehen hinter sich und ist mit jeder Scheidung ein Stück vermögender geworden. Ich bin zufrieden, dass mir wenigstens dieses Haus in Braderup ganz allein gehört.
Der Nachbar weiß es, trotzdem fragt er: „Wie geht’s Ihrem Mann? Hat er in diesem Jahr keine Zeit für Urlaub?“
Bevor die Affäre aufflog, hat Georg in dem Haus, das jetzt mir allein gehört, häufig ein paar Tage mit seiner Sekretärin verbracht. Angeblich war er mit ihr auf Geschäftsreise, manchmal in München, oft auch in Berlin. Jeden Abend rief Georg mich an und erzählte mir mit müder Stimme, wie anstrengend die Verhandlungen gewesen waren und wie triste der Abend sein würde, der vor ihm lag. Aber dann habe ich einmal eine Möwe kreischen hören, während ich mit ihm telefonierte. Eine Möwe in Berlin? Das war der Tag, an dem mein Misstrauen geweckt wurde. Natürlich habe ich gleich Elena davon erzählt, und die hat mich mit einem Privatdetektiv bekannt gemacht. Ihm hat sie ein gutes Stück ihres Vermögens zu verdanken. Ein guter Detektiv findet anscheinend im Leben eines jeden Menschen eine finstere Ecke, in der etwas geschieht, was niemand wissen soll. Ich bin froh, dass ich nicht in die Versuchung gekommen bin, es genauso zu machen wie Elena. Denn was ein Detektiv hätte herausfinden können, hat Georg mir alles freiwillig gestanden. Damals entdeckte ich zum ersten Mal, dass mein Leben Ähnlichkeit mit einem Groschenroman hat.
„Wir haben uns auseinander gelebt“, sagte Georg und schien nicht zu bemerken, wie billig sein Redestil war. Sich auseinander zu leben, das ist wirklich der trivialste aller Scheidungsgründe.
Johnny Gefron, mein Nachbar, wusste damals vermutlich längst, was gespielt wurde. Wahrscheinlich weiß er sogar, dass Georg jetzt Schorsch heißt. Und er hat auch mitbekommen, dass ich neue Betten gekauft und die alten rausgeworfen habe. Johnny, der eigentlich Johannes heißt, ist nichts Menschliches fremd, er kennt sich in den Geschichten anderer Leute aus. Schließlich ist er mit einer Verlegerin verheiratet, die mit Geschichten ihr Geld verdient. Sie hat ihn zum Abteilungsleiter für den Bereich Sciencefiction und Fantasy gemacht. Wahrscheinlich, weil er dort am wenigsten Unheil anrichten kann.
Georg kannte seinen Werdegang. Als Johannes Mende arbeitete Johnny Gefron bei der Post und nutzte seine Chance, als die frisch gebackene Verlegerin Tonia Gefron eine besonders eilige Sendung aufgab, zu der Johannes’ Kollegen nur die Schultern zuckten. „Vielleicht kommt’s morgen an, vielleicht auch nicht. Sendung per Eilboten? Das macht die Sache auch nicht schneller.“ Man kennt das ja.
Was Johannes getan hat, damit die Sendung tatsächlich pünktlich ankam, wusste Georg nicht. Aber es muss Tonia Gefron beeindruckt haben. Denn es dauerte nicht lange, und aus Johannes wurde Johnny. Da der Gefron-Verlag sich gerade einen Namen machte, änderte Johannes zu seinem Vor- auch den Nachnamen und heißt seitdem Gefron wie seine Frau. Als Tonia dann David Davidson entdeckte und ihn zum Beststellerautor machte, konnte Johnny nicht mehr bei der Post arbeiten. Wie sah denn das aus? Er wechselte also in den Verlag, erhielt eine leitende Funktion und ein paar tüchtige Mitarbeiter, die unauffällig alle Schäden beseitigten, die Johnny anrichtete. Seit die Gefrons sich das Haus in Braderup leisten können, wird Johnny immer öfter von seiner Frau zur Erholung nach Sylt geschickt, damit seine Mitarbeiter Gelegenheit haben, die Abteilung Sciencefiction wieder auf Vordermann zu bringen.
Johnny Gefron hat anscheinend keine Ahnung, dass ich eine Menge über ihn weiß, sonst würde er mich nicht behandeln wie ein dummes Frauchen. Vielleicht sollte ich endlich auf jede Höflichkeit pfeifen und ihn behandeln wie ein dummes Männchen?
„Wo mein Mann Urlaub macht, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht hier! Nicht in meinem Haus!“
Wenn er jetzt nicht den Mund hält, erzähle ich ihm, was ich von seinem Toupet halte.
„Keine Zeit? Ja, so geht es uns Männern. Arbeit, Arbeit, damit unsere Frauen Urlaub machen können. Ha, ha.“
Ich könnte ihn erwürgen. Aber was ich von seinem Toupet halte, bleibt dann doch ungesagt. Bei nächster Gelegenheit werde ich es ihm vom Kopf fegen. Jawohl! Und am Ellenbogen sollte er mir nicht noch einmal begegnen. Beim ersten Mal hat Georg mir verboten, über das zu lachen, was Gefron derart stolz der Sonne und der Mitwelt entgegenreckte, dass er einen schmerzhaften Sonnenbrand davontrug. Ich hatte mir, weil Georg mich hinderte, auch kein Wort entschlüpfen lassen, als der Nachbar tagelang in einem locker gegürteten Bademantel im Garten herumlief und auf den Besuch am Strand verzichtete. Beim nächsten Mal wird Georg mich nicht hindern.
Im Hintergrund taucht plötzlich ein Mann auf, ein gut aussehender Mann, das ist sogar auf die Entfernung leicht zu erkennen. Die Grundstücke sind groß in Braderup, ich habe Zeit, ihn auf mich zukommen zu lassen. Hoch gewachsen ist er, schlank, dunkelhaarig, etwa in meinem Alter. Seine Hände stecken in den Taschen seiner weißen Hose. Er schlendert auf Johnny Gefrons Rücken zu und hat mich dabei fest im Auge.
Gefron dreht sich nicht um, als er ihn herankommen fühlt. Er macht uns bekannt, als wäre keiner von uns beiden würdig, dem anderen vorgestellt zu werden. „Das ist Raffael Sielmann, Sie kennen ihn sicherlich.“
Dass ich ihn nicht kenne, sieht Raffael Sielmann sofort. „Machen Sie sich nichts draus. Sie lesen vermutlich keine Zukunfts-Romane.“
Er lächelt mich an, als ginge er davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird. Und er hat Recht. So bald wie möglich werde ich in die Badebuchhandlung gehen und mir einen Roman von Sielmann kaufen, obwohl ich tatsächlich nie Zukunftsromane lese.
„Raffael wird eine Weile hier arbeiten“, erklärt Johnny Gefron. „Er braucht Ruhe. Hier ist er ja ungestört.“ Über sein Gesicht geht dieses Grinsen, das seinen meist schlüpfrigen Witzen vorauseilt. „Vorausgesetzt, Sie lassen ihn in Ruhe. Ha, ha!“
Dass er mir zutraut, mich an einen Mann heranzumachen, der ungestört arbeiten will, geht ja gerade noch an. Aber dass er lacht, als hätte er einen guten Witz gemacht, das erbittert mich. Wenn ich Johnny Gefron – und damit leider auch Raffael Sielmann – nicht augenblicklich den Rücken zukehre, kann ich für nichts garantieren.
„Ich fahre jetzt zum Strand. Schönen Tag noch!“
Meine Badetasche ist leicht, viel leichter als früher. Habe ich wirklich an alles gedacht? Ja, es fehlt nichts. Die dicken historischen Romane, die Georg am Strand zu lesen pflegte, damit er stundenlang nicht ansprechbar sein konnte, hatten eben ihr Gewicht. Nein, ich habe alles dabei. Liegetuch und Sonnenmilch, mehr brauche ich nicht. Vielleicht noch ein Schmöker meines Lieblingsautors? Ich entscheide mich für eine seiner Kurzgeschichtensammlungen. David Davidson wird oft der Meister des kleinen Liebesromans genannt, seine Kurzgeschichten berühren mich noch mehr als seine großen Romane. Wenn ich sie lese, fühle ich mich zu Hause. Zu Hause? Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ja, wenn ich David Davidson lese, fühle ich mich zu Hause.
Habe ich wirklich abgeschlossen? Alle Fenster und Türen verriegelt? Besser, ich sehe noch mal nach.
„Grüßen Sie Ihren Mann“, ruft Johnny Gefron mir nach. „Er soll mich bei Gelegenheit anrufen. Das letzte Mal hat er von einem Porsche gesprochen. Ich kann ihm einen besorgen. Ein Schnäppchen!“
Ja, alle Fenster und Türen sind gut verschlossen. Und antworten muss ich nicht. Was geht es mich an, dass Georg der zwanzig Jahre jüngeren Frau mit einem Porsche imponieren will? Wenn ihm das wichtig ist, dann soll er gefälligst dafür bezahlen. Ein Schnäppchen ist das Letzte, wozu ich ihm verhelfen werde.
Es dauerte nicht lange, da waren sie allein. Die anderen wollten nach der Ankunft in der Jugendherberge zum Strand laufen, um zu baden, auch Uschi. Und Paul war dankbar, als Sophia sagte: „Ich möchte lieber erst auspacken. Das Meer ist auch morgen noch da.“
Er konnte an ihrem Gesicht ablesen, dass sie an das Geschenk dachte. Sie war gespannt, freute sich darauf. Und sie nickte mit leuchtenden Augen, als er sie bat, im Garten zu warten. „Ich werde es holen. Bin gleich zurück.“
In dem Schlafraum, den er sich mit Rolf und Werner teilte, zog er das Blatt Papier aus seiner Reisetasche - und verlor prompt einen Teil seiner Zuversicht. Die Plastikhülle, die das Blatt schützen sollte, hatte nicht viel bewirkt. Das Blatt, das er herauszog, war gemasert von vielen Knicken und Falten. Paul dachte daran, dass Werner auf der Tasche gesessen hatte, während sie auf den Zug warteten, und dass sie, als Paul sie schwungvoll und äußerst lässig ins Gepäcknetz werfen wollte, einen Salto gemacht hatte, der sie auf den Schoß eines Sitznachbarn beförderte. Der war sehr ärgerlich gewesen und hatte die Tasche mit beiden Fäusten zusammengedrückt und sie Paul an die Brust geworfen.
Paul strich über das Blatt, um es zu glätten, aber das machte die Sache nicht besser. Er hätte sich vorher die Hände waschen sollen. Nein, er konnte sich nichts mehr vormachen. Aus der Kostbarkeit war plötzlich etwas Fadenscheiniges geworden.
Winzige Augenblicke der Angst durchlebte er, während er das Blatt Papier zwischen seinen Fingerspitzen drehte. Unmöglich, es Sophia als Geschenk zu überreichen! Plötzlich wog auch die Frage, ob man ’Leib’ mit ei oder ai schrieb, viel schwerer. Nein, er musste es anders anstellen. Er wollte ihr das Gedicht nicht geben, sondern es ihr vorlesen. Nur... was sollte er tun, wenn sie ihn anschließend bat: „Gib es mir, damit ich es vor dem Einschlafen noch einmal lesen kann.“ Heimlich ergänzte Paul: und nach dem Aufwachen, auf der Rückreise, unter der Schulbank und während der Mahlzeiten.
Sie würde es ihren Freundinnen zeigen und ihren Eltern und Geschwistern. „Schaut mal, dieses Gedicht hat Paul geschrieben! Nur für mich! Wie findet ihr das?“
Alle würden das Blatt ansehen und über seine Rechtschreibfehler lachen oder über die grauen Äderungen, die von allen vier Ecken über das Blatt fingerten. Das alles würde am Ende wichtiger geworden sein als das, was er Sophia zu sagen hatte.
„Ich werde das Gedicht noch einmal sauber für dich abschreiben“, würde er ihr antworten und sich vorher irgendwo erkundigen, wie man ’Leib’ schreibt.
„Was ich dir sagen will...“, begann er eine halbe Stunde später und sah in ihre großen grauen Augen.
Sophia starrte auf das Blatt Papier. Sah sie, dass seine Hände zitterten?
Sie saß in einem der Strandkörbe, die es im Garten der Jugendherberge gab, er hockte vor ihr im Gras. Sie die Königin, er ihr Hofnarr, der sie mit seinem Geschenk unterhalten wollte. So jedenfalls kam es ihm plötzlich vor. Ob sie das Pflaster störte, das auf seiner Stirn prangte? Eine dumme Angewohnheit von ihm, Schranktüren zu öffnen und nicht wieder zu schließen! In diesem Fall ganz besonders, weil der Schlüssel, der im Schloss der Schranktür steckte, viereckig war und jede der vier Ecken zu spitz für einen aufgeregten Jungen, der schon bei geringeren Gemütsaufwallungen die Körperbeherrschung verlor.
Ob er seine Situation verbesserte, wenn er aufstand? Aber er wollte genauso wenig auf sie hinabblicken. Und sich zu ihr in den Strandkorb setzen wollte er auch nicht. Was er ihr zu sagen hatte, brauchte Platz. Ein bis zwei Meter mindestens.
„Was ich dir sagen will...“, begann er noch einmal.
Jetzt schien sie zu begreifen, dass er nicht mit ihr redete, sondern ihr etwas vorlas. Sie zupfte den Saum ihres hellblauen Minirocks zurecht und richtete sich auf. So hatte er sie auch sitzen sehen, als sie gemeinsam zur Konfirmation gegangen waren. Sehr aufrecht, die Füße nebeneinander gestellt, den kurzen Rock so weit wie möglich zu den Knien gezogen. Die kleinen Spitzen der Angst, die aus seinem Verlangen stachen, wurden flacher und runder. Und er selbst wurde ruhiger. Der Augenblick, den er sich ausgemalt hatte, schien genauso feierlich zu werden, wie er gehofft hatte.
„Was ich dir sagen will...“ Nur nicht die Stimme senken! Die Überschrift musste sich an die erste Zeile schmiegen. „...das klopft mein Herz, das atmet mein Mund...“
„Wollt ihr am Grillabend teilnehmen?“, fuhr da eine Stimme aus einem der Fenster. „Ihr müsst euch bis sieben entscheiden, danach könnt ihr nur noch Butterbrote beanspruchen.“
Paul drehte sich nicht um, sah nur in Sophias Gesicht. Sie schüttelte so jäh den Kopf, als wollte sie eigentlich nicken.
„Fragt eure Freunde! Und sagt mir dann möglichst schnell Bescheid!“
Ob dem Herbergsvater klar war, was er anrichtete? Ein grober Klotz, der eine Gedichtzeile zerschnitt wie eine Grillwurst. Dass es in diesem Fall nicht reichte, die beiden Teile aneinander zu schieben und den Schnitt mit Zigeunersauce zu übergießen, um wieder etwas Ganzes vor sich zu haben, darüber machte er sich keine Gedanken.
„...das klopft mein Herz, das atmet mein Mund. Es schmiegt sich in die Wölbung deines Leibes...“
„Das Wasser ist super! Nicht zu kalt, nicht zu warm, genau richtig!“
Als er Uschis Stimme erkannte, wusste er, dass alles vorbei war. Das Gedicht war nicht mehr zu retten. Sein Geschenk wurde für Sophia zu etwas, was Omas handgeknüpfter Teppich für seine Mutter gewesen war. Peinlich! Rolf und Werner hätten vielleicht gemerkt, dass sie störten, und sich zurückgezogen, Bärbel und Elena hätten sich so lange die Füße abgetrocknet, bis Pauls Stimme wieder die alte gewesen wäre und Sophias Miene die feierliche Erwartung verloren hatte. Aber nicht Uschi. Sie fragte zwar: „Störe ich?“, wartete aber nicht auf eine Antwort. Und als sie in die Küche lief, um sich etwas zu trinken zu holen, war sie schon zu lange da gewesen. Und vor allem: Sophia hatte bereits das erste Mal gekichert. In ihr Gesicht war dunkelrote Verlegenheit gestiegen, Verunsicherung war dazugekommen, als Uschi mit ihren flinken Augen der Situation auf den Grund ging. Und schließlich erschien sogar Ablehnung in ihrer Miene. Am Ende konnte Paul das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden. Als Sophia zum zweiten Mal kicherte, musste er einsehen, dass sie sein Geschenk nicht mehr wollte. Sie kicherte erneut, als Uschi mit einer Flasche Regina aus der Küche kam, und kicherte in einem fort, als auch die anderen vom Strand zurückkehrten. Wenn Mädchen kicherten, konnte alles mögliche dahinter stecken, Zustimmung, Scheu, Zurückweisung oder noch vieles mehr, was meistens nur Mädchen verstanden. Aber als Sophia es zuließ, dass Uschi sich des Gedichtes bemächtigte, wusste Paul, was er von ihrem Gekicher zu halten hatte. Dass er gerade in dem Augenblick, in dem Uschi ihm das Blatt aus der Hand nahm, heftig niesen und dann auch noch feststellen musste, dass er kein Taschentuch dabei hatte, war auch schon egal. Und dass Sophia noch schriller kicherte, als er den Ärmel seines Hemdes benutzte, darauf kam es ebenfalls nicht mehr an.
Er hatte sie aufwühlen wollen, wie er selbst von Wolf Biermann aufgewühlt worden war. Nicht, dass er sich mit Wolf Biermann vergleichen wollte! Höchstens ganz leise, unhörbar, tief in sich drin. Er wollte mit seinem Gedicht nicht kritisieren, glossieren, enthüllen oder mahnen. Er wollte sich ausdrücken auf eine ganz besondere Weise, wollte Sophia mit schönen Worten bewegen und ihr Herz angreifen.
„Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut...“, so hatte Wolf Biermann gesungen. Und Paul wollte es so halten wie er. Nicht warten, sondern den Mut haben zu handeln. Sophia nicht zeigen, was sie ihm bedeutete, sondern es ihr sagen. Aber nicht mit seinen Worten, nein. Mit denen der Poesie wollte er es ausdrücken, mit Worten, die sie nie vergessen, die niemals ein anderer für sie finden würde.
Trotzdem endete das, was er Sophia sagen wollte, eine Stunde später auf dem Holzkohlengrill, wurde mit Ketchup und Senf bekleckert und schließlich mit billigem Dosenbier heruntergespült. Dass es gelungen war, dieses Bier in die Jugendherberge zu schmuggeln, war wichtiger geworden als das, was Paul Sophia sagen wollte. Und die Frage, wer am meisten von dem Bier vertrug, wurde zum Allerwichtigsten. Am Ende war es Sophia, die am wenigsten vertrug, der schon schlecht wurde, bevor Uschi sich an Paul heranmachte. Der Mut, um den er lange ringen musste, auf den er nicht warten wollte, hatte sich nicht bezahlt gemacht.
„Gebt unserem Dichter noch ein Extrabier“, grölte Werner.
„Wenn du wenigstens was Sozialkritisches schreiben würdest“, nörgelte Rolf.
„Antikriegstexte oder so was“, ergänzte Elena.
Und sogar Bärbel, deren Vater Lehrer war und die damit einen denkbar schlechten Hintergrund für das Aufbegehren gegen die etablierte Gesellschaft bot, sagte: „Liebesgedichte sind kleinbürgerlich, regelrecht spießig.“
Spießig und bürgerlich, diese Begriffe waren soeben zu schlimmen Schimpfwörtern geworden. Kleinbürgerlich war das Allerschlimmste. Damals gehörten sie dazu, zu den kleinbürgerlichen Spießern, die ganze Clique, aber niemand wollte es sehen, und jeder bildete sich ein, schon zur Revolution zu gehören, wenn er die Haare lang trug und sich nur noch selten wusch. Und wohl dem, der einen echten Arbeiter im Stammbaum hatte! Am besten der Vater. Darin war Paul zum Glück allen anderen voraus.
Nur Sophia und Uschi schwiegen. Sophia, die gelegentlich über Rassendiskriminierung lamentierte, trug diesmal nichts zu der Debatte bei, und Uschi, die sich gern über Klassenunterschiede ereiferte, blieb ebenfalls still. Damals wusste Paul nicht, aus welchem Grunde.
Warum hatte er nicht geschafft, was Wolf Biermann gelungen war? Mit Scharfsinn, Wortgewalt und Poesie alles andere zum Schweigen zu bringen! Biermann hätte sich nicht übertönen lassen von der Frage, wie viele Grillwürste jedem zustanden, er hätte sich behauptet und hätte wiederholt, was er zu sagen hatte. So lange, bis man ihm zugehört und ihn ernst genommen hätte. Wolf Biermann hätte sich auch nicht auslachen lassen. Er hätte weiter gesungen, weil er wusste, dass er Recht hatte. Paul fand auch, dass er Recht hatte, aber er schaffte es trotzdem nicht, sein Gedicht zu verteidigen. Er musste es billigen Grillwürsten und warmem Dosenbier opfern. Damals war wohl die Angst entstanden, unter der er vierzig Jahre später noch litt. Die Angst, etwas Wichtiges zu sagen, was in dem Augenblick, in dem er es sagte, seine Bedeutung verlor. Was in seinem Kopf war, was er zu Papier brachte, hatte Gewicht. Aber wenn er es aussprach, wurde es verramscht. Diese Überzeugung hat sich vor vierzig Jahren in ihm festgesetzt und ihn nie wieder verlassen.
Trotzdem hat er sich für Sylt entschieden. Ausgerechnet für Sylt!